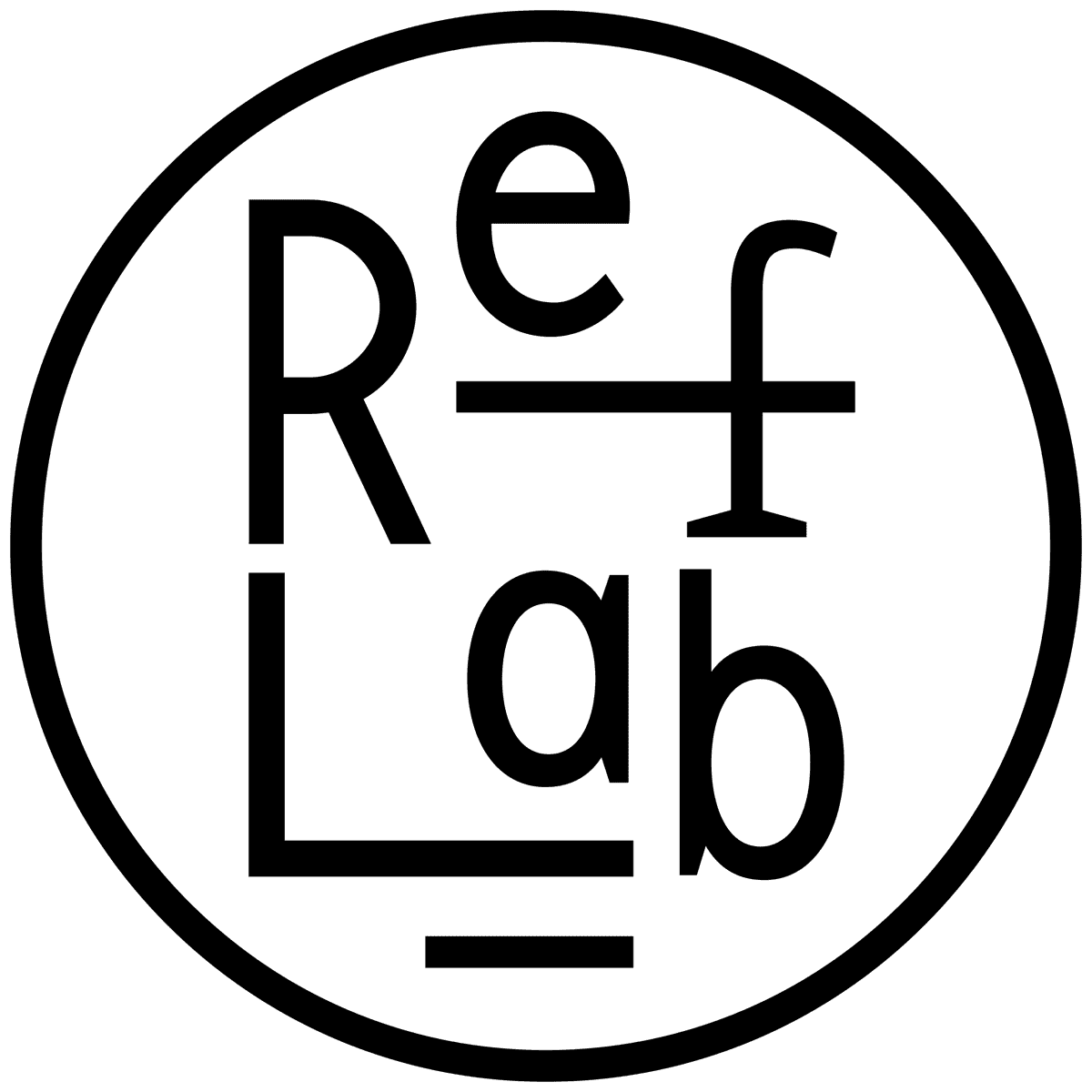In der Nacht hat es wieder geschneit. Vögel und kleine Huftiere, wahrscheinlich Rehe, haben rund um die Klinik ein Netz sich kreuzender Pfade hinterlassen. In der Cafeteria treffe ich Friedrich, der ein Heft mit lauter Zeichnungen und Gliederungen voll malt. «Das Kind», «der Nörgler», «der Souverän». Seine Therapeutin hat ihm geraten, die inneren Stimmen zu einem Theater zu sortieren. «Schizoide Affektivität» hat er in seinem Heft doppelt unterstrichen, die jüngste Diagnose. Die Tätigkeit erregt ihn freudig.
Friedrich hält sich für eine Art Gott. Er läuft wie ein Hypnotiseur durch die Anstalt und schart Menschen wie Jünger um sich, die unterschiedlichsten Typen. Entwaffnend direkt und meist messerscharf analysiert er in Pausen, am Abendessenstisch oder in Gruppensitzungen Eigenheiten seiner Mitpatienten und konzentriert seine Aufmerksamkeit auf die Besonderheit eines jeden. Er hat ein feines Gespür für Schwachstellen und Defizite anderer, die er aber so benennt, dass es eher hilft als schmerzt.
Der Operngeiger ist inzwischen sicher, dass er über Warnsignale hinausgeschossen und unrettbar in die Psychose eingebogen sei. Als er abends zu unserem English Club im Kaminzimmer dazustösst, wechseln wir ins Deutsche, um ihm keine Zusatzanstrengung zu bereiten. Aus dem vornehmen ruhigen Mann – ich hatte ihn zunächst für einen Naturwissenschaftler gehalten – ist ein aufgewühlter Mensch geworden, das Gesicht leicht aufgedunsen, die Augen jetzt unruhig, panisch, die Gesichtsmuskeln zuckend.
Das Kaminfeuer knistert, während es draussen dunkel wird. Wir sitzen zu fünft bedrückt in weichen Couchsesseln um ein Adventsgesteck herum: drei Psychotiker, ein nervengeschädigter Trinker und ich. Die Angst des blassen Geigers legt sich plötzlich auf meine Brust, wie ein kühles Luftkissen, und lässt auch mein Herz rasen. «Ich spüre Deine Angst», höre ich mich zu ihm sagen. Der Geiger versucht, seine Angst mit Sarkasmus zu überspielen.
Es ist, als würde er noch nehmen wollen vom Leben, was geht, bevor er in den Abgrund stürzt.
Er wäre gern Kunstkritiker geworden, welche Ausstellung ich zuletzt gesehen hätte, er ginge leidenschaftlich gern in Ausstellungen, sagt er in überstürzten Wortkaskaden, er betreibe «Kulturkamikaze», er liebe «Hälfte des Lebens» von Hölderlin. Dazwischen blitzt für Bruchteile etwas Kasperlhaftes auf. Es wirkt, als würde mit ihm der Schlitten abgehen. «Yippie», ruft er plötzlich und blickt einen Doppelblick: komisch und bitter zugleich.
Eigentlich müsste er sofort weg. Der Wald und die Klinik mit dem durchgetakteten, obligatorischen Tagesprogramm ähneln fatal jenem Ort in Schweden, wo er in einer Hochbegabtenschule Geige studieren sollte und wo er seinen ersten Zusammenbruch erlebte. Die zweite Krise erlitt er, nachdem beide Elternteile in kurzem Abstand gestorben waren, der Vater an Krebs, die psychisch kranke Mutter durch suizidalen Fenstersprung.
Eine Psychotherapie habe er bisher vermieden, in der Hoffnung, es ohne fremde Hilfe zu schaffen. Ich würde ihn am liebsten festklammern, um das Stürzen aufzuhalten. Die Nacht wird der Geiger hoffentlich überstehen. Morgen sollte er den Ort schleunigst verlassen, heimkehren zur Ehefrau, ins gewohnte Umfeld. Daheimgeblieben würde er an diesem Abend vielleicht in der Oper der Provinzstadt Wagner spielen. Bevor er sein Zimmer betritt, greift er sich an den Kopf und klagt: «Ich habe mich selbst für den Kuraufenthalt angemeldet.»
Das Abschiednehmen an diesem Abend ist tief melancholisch. Abschied bis auf Weiteres von der Welt der Klardenkenden, ihrer selbst Bewussten? Eine Reise in Alpträume, nackte Ängste, Besinnungslosigkeit, Verlust von Lebenswochen, vielleicht Lebensmonaten? Ich sage, dass mir sein Zustand nicht so wahnsinnig vorkomme, wie der Wahnsinn in der Stadt, an den Arbeitsplätzen. Aber spüre sogleich, dass jedes Wort in diesem Moment ein Wort zu viel ist, eine weitere Belastung für den Mann am Abgrund.
Am nächsten Tag in aller Frühe sehe ich einen Rettungswagen vor der Klinik parken. Er bringt den Musiker mit Blaulicht in eine psychiatrische Anstalt. Er wird Weihnachten dort verbringen müssen. Der Mann war zuletzt wie ein Schlafwandler herumgegangen, von Stunde zu Stunde war er mehr in sich hineingesunken, hatte die Schotten dicht gemacht, sich gegen die unerträgliche Reizfülle zu schützen versucht, dabei waren innen und aussen wohl schon ineinander implodiert.
Ich konversiere auf Englisch mit einer Bibliothekarin, die mit Raben spricht, ich wohne Wand an Wand mit einem Werwolf, der nachts dumpfe Laute von sich gibt, und im Zimmer gegenüber meinem ringt ein liebenswerter Geiger mit dem Abgrund. Mein Leben in der Stadt erscheint inzwischen wie entrückt. Die Klinikwelt ist in den Vordergrund getreten, aber ich bin froh, ein Zuhause ausserhalb des Waldes zu haben, in das ich nach meiner Kur zurückkehren werde.
Der Kuraufenthalt war Mitte der 2010er-Jahre. Die Namen der Klinikinsassen sind geändert.
Illustration von David Nydegger für RefLab.