Bei mir keimt Sozialstress auf. Während des Abendessens gemeinsam mit anderen Patienten in der Klinikmensa. Ich habe heute keine Lust auf Smalltalk. Ich fühle Fluchtimpulse und suche nach Ausflüchten. Zugleich wird mein Stress dadurch noch gesteigert, dass ich ahne, dass Ausreden gerade hier schwierig sind. Weil ich mich unter Menschen befinde, die sehr gut darin sind, sich aus belastenden Situationen herauszustehlen. Und sehr schlecht darin, sich als taktvolle Ausfluchthelfer anderer zu betätigen. Ich sage dennoch, ich sei müde und wolle deswegen zu Bett gehen.
«Aha, du läufst davon», antwortet prompt meine sensible Mitpatientin mit Borderline-Diagnose. Und schon beginnt die Runde mit Diagnosen. Ein Mitpatient meint, es gebe die Sprache des Kopfes und die des Herzens. Das bodenlose Gefühl stelle sich ein, wenn man einseitig mit dem Kopf kommuniziere. Beim Registerwechsel auf Herz aber könne es nett werden.
Ein anderer Ratschlag, den ich bekomme, an diesem Abend, der nun doch entspannt und gemütlich geworden ist, wird zur Denkanregung: «Du denkst vielleicht, du müsstest Raum einnehmen und vielleicht spannt dich gerade das an. Du musst aber gar nicht Raum einnehmen. Wenn du dir das bewusst machst, wirst du schlagartig von der Raumunklarheit erlöst.»
Diese Empfehlung ist das exakte Gegenteil dessen, was Ratgeber für das Überleben im Berufsalltag empfehlen. Dort geht es darum, Raum selbstbewusst zu besetzen, damit er nicht von anderen eingenommen wird. Kämpfe um Raum hatte ich in den vorangegangenen Monaten in der Stadt zur Genüge erlebt. Mein Arbeitsplatz hatte sich binnen weniger Monate in eine Nahkampfzone verwandelt, ein ideales verhaltenspsychologisches Beobachtungsfeld.
Aus einem kollegialen Team war im Verlauf sogenannter «Change Prozesse» eine Art Wolfsrudel geworden.
Professioneller Austausch ist Dominanzgesten gewichen. Bei Teamsitzungen konnte man den Angstschweiss der anderen riechen.
Dominante Kollegen traten jetzt noch breitbeiniger auf, moderate Temperamente dagegen wurden kleinlaut. Einige versuchten, schwanzwedelnd, Anschluss an Leitwölfe des überwiegend männlich geführten Konzerns zu bekommen. Potenzielle Konkurrenten und gezielt auch Konkurrentinnen wurden immer aggressiver weggebissen.
Einige Kollegen schafften den Absprung, andere nahmen Kontakt zu Gewerkschaften und Anwälten auf, die ersten wurden «freigestellt». Ich war, ob ich wollte oder nicht, teilnehmende Beobachterin.
Unter den Ratgebern für das Überleben im verschärften Konkurrenzkampf, die ich konsultierte, war der schärfste: «Die acht Grundregeln der Peperoni-Strategie: Spice up your life» von Jens Weidner. Ein befreundeter Priester und Rhetorikexperte, der Spitzenmanager coacht, hat mir das Buch geraten: nicht zur Nachahmung, sondern als Warnung, mit welchen Kalibern im Arbeitsfeld heute im schlimmsten Fall zu rechnen sei. «Lies das, es ist der Wahnsinn!»
In dem Ratgeber geht es um den manipulativen Einsatz «natürlicher Aggression». «Zur notwendigen Handlungskompetenz der positiv Aggressiven zählt ein strategisch eingesetztes kommunikatives Repertoire vom einfühlsamen Bedrängen bis zum spontan-echt wirkenden Wutausbruch: die Klaviatur von Charme bis Vulkan!», heisst es darin. Es geht um «Gegenspieleranalysen», die Perfektion von Abwehrrhetorik und darum, sich «mit Power durchzusetzen».
Nach Monaten des Nahkampfes im Angstschweissklima bin ich dünnhäutig geworden und habe gleichzeitig das Gefühl, mich bewaffnen zu müssen, sogar wenn ich morgens meine kleine Schlafzelle in der Waldklinik verlasse und das inzwischen gewohnte Tagesprogramm an Gesprächen und Behandlungen absolviere. Dabei kommen mir die Menschen im Wald so viel menschlicher und normaler vor als viele Leute draussen. Die Menschen der Waldklinik begegnen einander mit auffallender Behutsamkeit.
Zwischen ihnen herrscht eine fast telepathische Kommunikation. Sie suchen die Augen der Mitinsassen nach Spuren aktueller Befindlichkeiten ab.
Viele in der Klinik sind beim Versuch, draussen konkurrenzfähig zu sein, zu bleiben oder wenigstens zu erscheinen, gescheitert. Keiner hier ist, was in Stellenannoncen mantraartig gefordert wird: überdurchschnittlich belastbar und aussergewöhnlich durchsetzungsstark.
«Du musst aber gar nicht Raum einnehmen.» Sollte ich mich vielleicht auf meine Schwächen als Stärken besinnen? Eine paradoxe Selbstintervention, die mir erprobenswert erscheint. Meine aktuelle Verfassung kommt dem Versuch entgegen. Meine innere Stimme urteilt nämlich nach Wochen im Winterwald und zahllosen Entspannungsübungen und Wellnessbehandlungen weniger hart über mich und ist weniger fordernd. Sie ist fast gütig. Die chronischen Migräneanfälle sind nicht überwunden, aber ich blicke ihnen gelassener entgegen. Ich traue mir sogar zu, auch um alte Verspannungen der Seele keinen Bogen mehr zu machen. Denn wo sonst ist Ausflucht auf Dauer unmöglicher als im Verhältnis zu sich selbst?
Der Kuraufenthalt war Mitte der 2010er-Jahre. Die Namen der Klinikinsassen sind geändert.
Illustration von David Nydegger für RefLab.
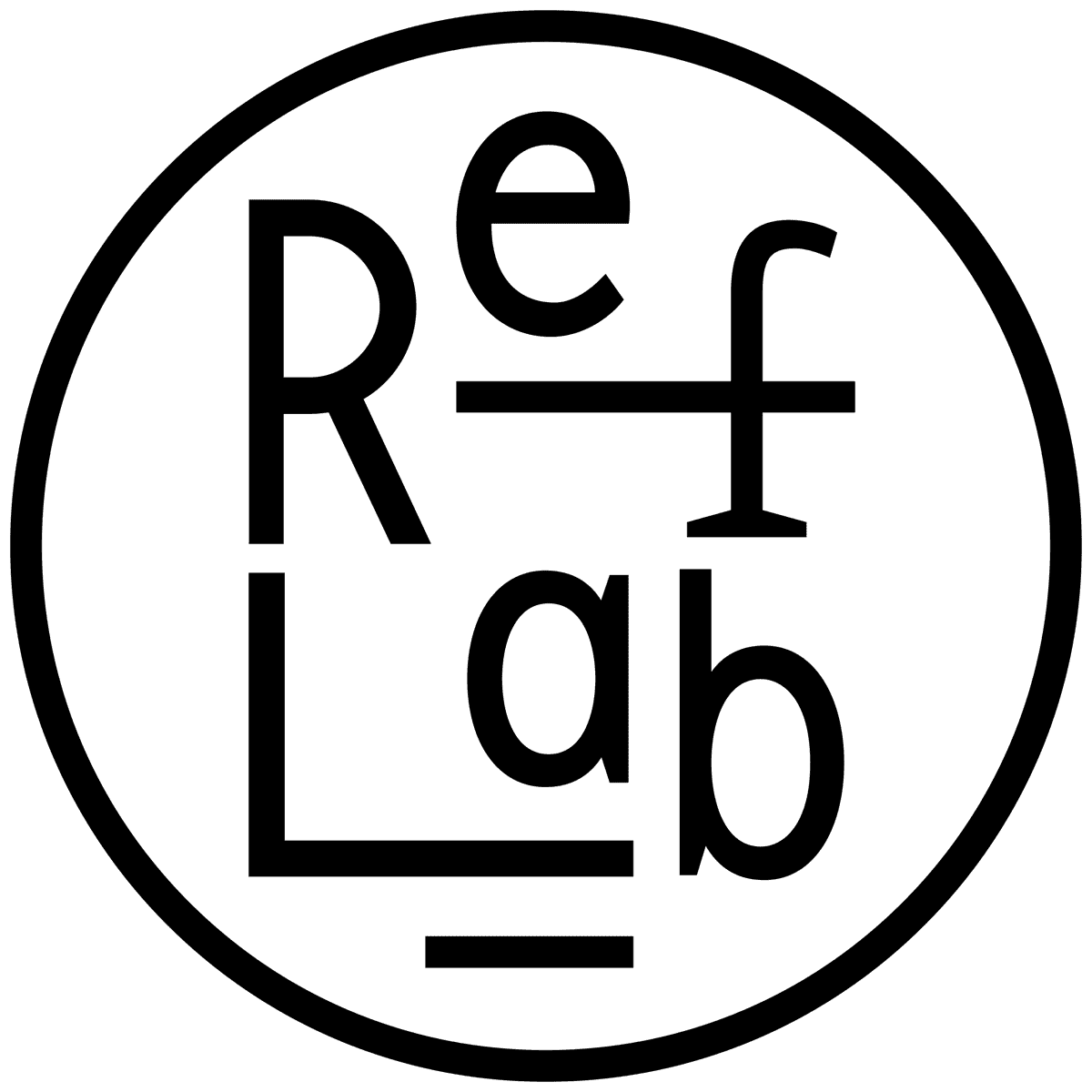









1 Gedanke zu „Zauberwald (6) Du musst keinen Raum einnehmen“
Glänzender Text!!!