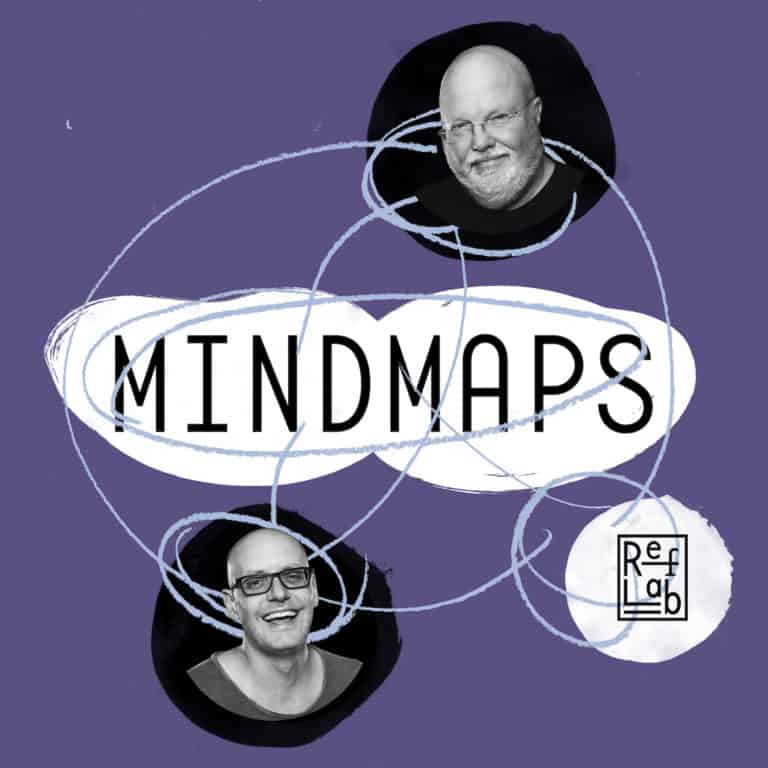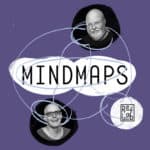Kopflose Zerstörungswut
Es war auf einer Schulreise in meiner frühen Primarschulzeit. Wir wanderten durch einen Wald, als die Blicke einiger meiner Klassenkollegen auf eine beachtliche Ansammlung von Pilzen am Wegrand fiel. Es war wohl ein Teil eines sogenannten «Hexenrings», der da stolz aus dem Boden ragte: weite, handflächengroße Hüte, die dicht beieinanderstanden und von oben betrachtet die Form eines Bogens andeuteten.
«Schaut mal, hier!», rief einer der Schüler aus – und bevor ich etwas erwidern konnte, stürzten sich einige Jungs aus meiner Klasse auf die Pilze, stampften sie nieder, kickten sie lachend in der Gegend herum und hörten erst auf, als auch das letzte dieser Lebewesen geköpft und zertreten war.
Eigenartig, dass mir ausgerechnet diese Anekdote aus meiner Kindheit in Erinnerung geblieben ist. Sehr viel könnte ich aus meinen ersten Schuljahren nicht mehr erzählen, aber das Bild dieser grölenden Horde wildgewordener Frühpubertärer, die im Zerstörungsrausch eine stattliche Pilzkolonie ausrotteten, hat sich irgendwie in mein Gedächtnis eingebrannt.
Und ich kann mich auch gut daran erinnern, dass ich davon ebenso betrübt wie abgestoßen war. So geht man nicht mit Pilzen um, schoss es mir durch den Kopf. Für mich war klar, dass ein solches Verhalten nur falsch sein kann, verurteilenswürdig – oder, um einen theologisch aufgeladenen Begriff zu verwenden: eine Sünde an der guten Schöpfung Gottes.
Diese Einschätzung war meiner Meinung nach nicht davon abhängig, ob es sich um «schöne» Pilze handelte, deren Zerstörung anderen Menschen eine ästhetische Erfahrung geraubt hätte. Oder ob die betreffenden Pilze essbar waren, so dass ihre Vernichtung einer Nahrungsmittelverschwendung gleichkam. Meine Trauer galt in diesem Moment schlicht diesen hochkomplexen und geheimnisvollen Kreaturen selbst.
Gigantische Lebewesen
Schon als kleiner Junge hatte ich nämlich einiges über Pilze in Erfahrung gebracht. Mein Vater ist mit mir und meinem Bruder jedes Jahr im Spätsommer durch die Wälder gezogen, auf der Suche nach Speisepilzen. Junge Schopftintlinge und Hallimasch, Täublinge und Boviste, manchmal auch Wiesenchampignons und Anistrichterlinge (Steinpilze und Pfifferlinge haben sich uns leider nie gezeigt) haben wir wie Schätze zur Pilzkontrolle gebracht und abends dann zu einer schmackhaften Pilzpfanne verarbeitet. An jedem Fundort ließen wir einige Pilze noch stehen – weil wir (wahrscheinlich zu Unrecht) dachten, dass die Pilze sich auf diese Weise leichter wieder vermehren –, und von Arten, die wir nicht kannten, haben wir ohnehin nur ein paar wenige Exemplare zur Bestimmung mitgenommen. Wenn er selbst auch alles andere als ein Spezialist war, so hat mein Vater doch mein bleibendes Interesse an Pilzen geweckt.
Wussten Sie, dass die Pilze biologisch neben den Tieren und den Pflanzen das dritte große Reich von Lebewesen bilden?
Sie sind sesshaft wie die Pflanzen, gewinnen ihre Energie aber nicht wie diese durch Photosynthese (weshalb sie auch nicht grün sind), sondern durch die Aufnahme organischer Substanzen. Überhaupt sind sie nach heutiger Kenntnis näher mit den Tieren als mit den Pflanzen verwandt.
Was man gemeinhin unter «Pilzen» versteht, sind eigentlich nur die Fruchtkörper, welche das unterirdische Myzel hervorbringt. Dieses weit verzweigte Geflecht breitet sich v.a. in der waldigen Erde aus und kann Dimensionen annehmen, die jede bekannte Pflanze und jedes Tier weit in den Schatten stellen. Der erwähnte Hallimasch etwa zeigt sich oft in großen Gruppen bräunlicher Fruchtkörper mit schuppigen Hüten. Ihr Myzel verbindet sich zu einem Organismus, der viele Hektaren abdecken und älter als jedes andere Lebewesen werden kann.
Der größte Hallimasch der Schweiz findet sich im Nationalpark in Graubünden. Er spannt sich auf der Fläche von ca. 50 Fußballfeldern aus und ist schon über 1‘000 Jahre alt.
Im US-Bundesstaat Oregon wurde im Jahr 2000 ein dunkler Hallimasch entdeckt, der sich über 900 Hektare erstreckte, rund 600 Tonnen schwer und nicht weniger als 2‘400 Jahre alt ist. Unter der Erdoberfläche wächst der Pilz unaufhaltsam vor sich hin und wird mit seinem Appetit sogar zu einer ernsthaften Bedrohung für den von ihm besetzten Wald.
In jüngerer Zeit ist in der Forschung klar geworden, dass die Myzele von Pilzen gewaltige Netzwerke im Untergrund von Gärten und Wäldern bilden, welche das Wurzelwerk von Bäumen, Büschen und anderen Pflanzen miteinander verbinden. Dieses organische «Internet» ermöglicht die Kommunikation zwischen pflanzlichen Lebewesen, sorgt für den Austausch von Nährstoffen und sogar für die Produktion toxischer Stoffe zur Abwehr von Schädlingen.
Verräterische Sprache
All das und vieles mehr bekommt man heute durch eine kurze Online-Suche von Google beigebracht. Man braucht dazu nicht einmal mehr das Haus zu verlassen. Dass diese Art der digitalen Recherche damals gereicht hätte, mir den Respekt vor Pilzen ins Herz zu prägen, wage ich allerdings zu bezweifeln. Es war die wortwörtliche Berührung mit der Umwelt, die Erfahrung in der Natur, die mich lehrte, diese Lebewesen wahrzunehmen und als bestaunenswerte Geschöpfe zu achten. Wobei uns solche Sprache längst als Teilhaber der (vornehmlich) westlichen Gesellschaften entlarvt.
Im Zuge der Technisierung und Digitalisierung des Lebens, an der Spitze mehrerer Industrialisierungswellen, sicher auch in Folge der fortschreitenden Urbanisierung unserer Bevölkerung, verstehen wir uns immer stärker als Gegenüber und nicht mehr als Teil der Schöpfung.
Die Prägung des Kollektivsingulars «Natur» als Gegenbegriff zur menschengemachten «Kultur» spricht in dieser Hinsicht Bände. Er setzt bereits voraus, dass sich das kulturelle Leben des Menschen von den Rhythmen und Rahmenbedingungen der Natur weitgehend emanzipiert hat; dass nicht mehr der Auf- und Niedergang der Sonne, die Temperaturen verschiedener Jahreszeiten, Saat und Ernte oder das Wetter unseren Alltag strukturieren, sondern die Eigendynamik westlicher Gesellschaften.
Eben darum sprechen wir gerne davon, wieder einmal «in die Natur» gehen zu müssen, um zu entspannen, zu uns selbst zu finden, unsere Wurzeln zu spüren. Als ob wir sonst im luftleeren Raum außerhalb der Natur leben würden. Und wir reden gerne von der Sorge für unsere «Umwelt» – womit wir uns schon semantisch ins Zentrum stellen und nicht nur alle anderen Geschöpfe gewissermaßen um uns herum anordnen, sondern uns von ihnen auch abgrenzen:
Hier ist der Mensch, umgeben von seiner Umwelt. Dabei sind wir doch selbst genauso Umwelt, und die Umwelt darum vielmehr unsere «Mitwelt». Schon die Begrifflichkeit, mit der wir unser Verhältnis zur Schöpfung fassen, in die wir hineingestellt und deren Teil wir selber sind, offenbart einen Entfremdungsprozess.
Verhängnisvolle Wissenserosion
Die geistigen Früchte dieser Entfremdung haben in den vergangenen Jahren immer mal wieder Schlagzeilen gemacht. Berühmt geworden sind die Angaben deutscher Schüler zur Fellfarbe von Kühen. Offenbar ernsthaft und in erschreckender Häufung wurde diese schon vor ca. 20 Jahren mit «lila» angegeben – weil die einzigen Kühe, welche die befragten Stadtkinder noch zu sehen bekamen, die lilafarbenen Kühe aus der Milka-Schokoladenwerbung waren.
Viel Kopfschütteln haben dann auch die Zeichnungen sechsbeiniger Hühner ausgelöst, welche Lehrern in den USA wiederholt Rätsel aufgegeben hat. Die Auflösung war freilich denkbar einfach:
Weil in der Supermarktkette WALMART Hühnerschenkel vorzugsweise in einer 6er-Familienpackung verkauft wurden, gingen die Kinder davon aus, dass das zugehörige Tier auf sechs Beinen unterwegs war. Eine ähnliche Logik lässt Kinder auch hierzulande gerne annehmen, Fischstäbchen würden aus viereckigen Fischen hergestellt.
Der Natursoziologe Rainer Brämer hat bereits 2006 die Ergebnisse einer Untersuchung zum Verhältnis von Natur und Mensch als «desaströs» bezeichnet. Er spricht von einer regelrechten Wissenserosion im Blick auf die allgemeinen Kenntnisse der heimischen Flora und Fauna. Jugendliche hätten in der Regel keine fünf Kräuter mehr nennen können, wüssten oft nicht mehr, dass Raps gelbe Blüten trägt und seien außer Stande, eine Amsel von einem Spatzen zu unterscheiden. Offenbar habe die über Generationen erfolgte Weitergabe des Naturwissens in unserer Zeit einen empfindlichen Bruch erlitten.
Diese fehlende Kenntnis dessen, was der Mensch «Natur» nennt, wirkt sich verhängnisvoll auf die Ernährung, den Umgang mit natürlichen Ressourcen, das Verhalten in Naherholungsgebieten und überhaupt auf die Wertschätzung der Mitschöpfung aus. Denn nur was man kennt, kann man auch angemessen behandeln und wertschätzen.
Moderne Verzweckung
Den genannten Beispielen (post)moderner Naturentfremdung ist gemeinsam, dass sie mit einer Verzweckung der Schöpfung einhergehen oder aus ihr erst resultieren: Kühe werden als folkloristisches Werbemittel eingesetzt, Hühner und Fische treten erst nach ihrer Verarbeitung zur menschlichen Nahrung vor Augen. «Kann man die essen?» ist dann auch die erste und vordringlichste Frage, die viele Menschen beim Anblick unbekannter Pilze oder Tiere stellen – dicht gefolgt von der Frage, ob diese Lebewesen denn gefährlich sind (gemeint ist natürlich: für den Menschen…). Im Falle einer doppelt abschlägigen Antwort lässt das menschliche Interesse oft rasant nach:
Ein weder verwertbares noch bedrohliches Geschöpf kann höchstens noch schön oder niedlich sein – dann machen wir es zum Haustier und fügen es in unseren eigenen Lebensraum ein.
Gegen Letzteres ist grundsätzlich nichts einzuwenden, genauso wenig wie gegen Schrebergärten oder den Trend zum «urban gardening». In unserer westlich zivilisierten Gesellschaft kommen viele Menschen erst durch Haustiere oder eigene Gartenbeete überhaupt mit nicht-menschlichen Lebewesen näher in Berührung. Man sollte sich aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch diese Annäherungen an die «Natur» noch in einem (ästhetischen oder emotionalen) Verwertungszusammenhang stehen. Schließlich werden Hunde, Katzen und andere domestizierbare Tiere üblicherweise nicht angeschafft, um seltene Arten zu bewahren oder den Tieren eine besonders naturgemäße Lebensweise zu ermöglichen, sondern um ein seelisches Gegenüber zu gewinnen, Kinder zu erfreuen, eine erfüllende Freizeitbeschäftigung zu finden oder der eigenen Einsamkeit zu entfliehen.
Und natürlich war das auch früher nicht fundamental anders. Mir ist nicht daran gelegen, das Naturverhältnis früherer Generationen zu glorifizieren oder der Idee einer erst in der Neuzeit verloren gegangenen Unversehrtheit der Beziehung zwischen Mensch und Tier nachzuträumen. Auch auf den Höfen und Weiden vergangener Zeiten wurden Tiere nicht um ihrer selbst willen gehalten, sondern für den Menschen nutzbar gemacht. Und auch damals wird es Formen der Geringschätzung, Ausbeutung oder gar Misshandlung von Lebewesen gegeben haben.
Es lässt sich allerdings schwer in Abrede stellen, dass der alltägliche Umgang mit Vieh und Wildtieren, die unmittelbare Abhängigkeit von den Früchten des Feldes und die verbreiteten Fertigkeiten in der Aufzucht von Tieren und Pflanzen ein ganz anderes Verständnis für die Eigenheiten und Dynamiken der nichtmenschlichen Schöpfung hervorbrachten – und dass Anknüpfungen an ein solches Verständnis in unserer Zeit heilsam wären.
Heilsame Vertrautheit
Hoffnungsvoll an der gegenwärtigen Ausgangslage ist, dass sich etwas daran ändern lässt.
Letztlich geht es um einen gesellschaftlichen Bildungsauftrag im ganzheitlichen Sinne. Eltern, Schulen und öffentliche Einrichtungen sind herausgefordert, sich mit den nachwachsenden Generationen nicht nur neu auf die «Natur» einzulassen, sondern auch das Bewusstsein dafür fördern, dass wir selbst Teil davon sind.
Nicht nur, aber gerade unter Kindern kann eine Entdeckungsfreude im Blick auf unsere Mitschöpfung, eine Fähigkeit zu ihrer Beobachtung und eine Kenntnis der Verflechtungen und Wechselwirkungen zwischen Menschen, Tieren und Pflanzen (und Pilzen!) gefördert werden. Dass sich hierzu auch von biblischen Überlieferungen einiges lernen lässt, ist im letzten Beitrag deutlich geworden. Und wie solche Annäherungen in unserer Zeit aussehen können, habe ich in der Schulerfahrung unseres Sohnes miterleben können.
Sein Lehrplan hatte für die vierte Primarschulklasse offenbar das Thema «Huhn und Ei» vorgesehen. In einem eigens gestalteten Heft hatte er zahlreiche Informationen zur Lebensweise von Hühnern, zu ihrer Ernährung und Lebenserwartung sowie zu den Entwicklungsstadien eines Kükens festgehalten und mit Bildern illustriert. Allzu viel Begeisterung hätte er dafür aber wohl nicht entwickelt – wenn die Lehrerin nicht bereit gewesen wäre, befruchtete Hühnereier anzuschaffen, sie in einem Brutapparat zum Schlüpfen zu bringen und im Klassenzimmer einen Hühnerstall aufzubauen, in dem die Kinder mit den Küken in Berührung kommen konnten. Immer wieder hat unser Sohn vom aktuellen Entwicklungsstand der Hühner berichtet, wir waren als Eltern sogar selbst mehrmals bei den «Klassen-Hühnern» zu Besuch.
Der Mehraufwand der Lehrerin hat sich für die Schüler zweifellos gelohnt. Noch heute wird diese Erfahrung immer mal wieder zum Thema – und sie bietet Anknüpfungsmöglichkeiten zum Gespräch über Fleischkonsum, Haltungsbedingungen und menschliche Verantwortung für seine Nutztiere.
Auch wenn sich damit viele Diskussionsfelder und tierethische Fragen erst auftun, so wird man doch festhalten können: Ein angemessener, wertschätzender Umgang mit nichtmenschlichen Lebewesen ist ohne Aufmerksamkeit, Begegnung und wachsender Vertrautheit nicht zu haben.