1 – Postevangelikalismus: Eine Hinführung
2 – Teure Gnade
Das Phänomen des Evangelikalismus lässt wenig Raum für wohltemperierte Neutralität. Für einige ist es die Sammlung der wahren, wiedergeborenen Gläubigen. Für andere steht das Wort überwiegend für eine rechte und fundamentalistische Glaubensweise. Beides wird weder der Vielfältigkeit noch dem geschichtlichen Wandel dieser Bewegung gerecht. Die Frage nach dem eigentlichen Wesen bzw. der wirklichen DNA der Evangelikalen führt leicht in die Irre. Ich ziehe es daher vor, von zentralen Grundmerkmalen des Evangelikalismus (wie dem Bebbington-Quadrilateral aus Folge 1) auszugehen; und in der jeweiligen Aktualisierung gleichermaßen mit Chancen und Gefährdungen zu rechnen.
Typisch evangelikal ist auf jeden Fall auch die starke Betonung dichter Gemeinschaft.
Es gibt keine lebendige Glaubenspraxis ohne Formen intensiver Vergemeinschaftung.
Noch der privateste Glaube setzt solche soziale Lebensformen voraus. Andernfalls gäbe es für den individuellen Glaubensweg gar keine Sprache bzw. Symbolwelt, mit deren Hilfe sich so etwas wie Gläubigkeit zum Ausdruck bringen könnte. Schon der pietistische Graf Zinzendorf betonte, es gebe kein Christentum ohne Gemeinschaft.
Eine lebendige evangelikale Gemeinde besucht man nicht, ohne angesprochen zu werden. Nach jedem Gottesdienst gibt es Gelegenheit zum persönlichen Gespräch mit anderen, bei Kaffee und mehr. Es gibt keine reinen Gottesdienstgemeinden. Wer dazugehört, besucht Kleingruppen und engagiert sich über den Sonntag hinaus. Und mehr noch: Entscheidend ist der gemeinsame Glaube. Die Botschaft lautet: So glauben wir; und du kannst dazugehören.
Teile unseren Glauben – und werde dadurch Teil unserer Gemeinschaft.
Nichtevangelikale Kirchen legen häufig großen Wert darauf, Menschen nicht zu indoktrinieren. Allein: man dankt es ihnen oft nicht. Jede Gemeinschaft lebt von Codes der Zugehörigkeit und der Nichtzugehörigkeit. Darum sind Kirchen, die für alle offen sind, nicht selten recht leer.
Wo alle willkommen sind, gehört längst noch nicht jeder dazu; im schlimmsten Fall niemand so richtig. Die totale Inklusion kann auch große Distanziertheit mit sich bringen.
Weltweit boomt Religion mit eindeutigen und expliziten Angeboten. Weite und Vielfalt bietet die moderne Gesellschaft genug. In Sachen Religion scheint die Sehnsucht nach Klarheit zu überwiegen, nach Angeboten, die sagen: Hier ist links und da ist rechts, so sieht schwarz aus – und so weiß.
Solche Modelle bedienen ein Bedürfnis nach Orientierung. Mehr noch: Sie bieten überhaupt ein klares Artikulationsangebot, mit dessen Hilfe Glaube sich seiner bewusst werden und zur Sprache finden kann. Wer die Botschaft „Ich bin von Gott geliebt“ nach- und ausspricht, wird nicht selten erst auf diesem Weg in die Erfahrung von Halt und Geborgenheit hineinwachsen. Und noch mehr: Eine klare und gemeinsam geteilte Glaubensbotschaft macht Vergemeinschaftung möglich.
Denn was unterscheidet eine Gemeinschaft von einer bloßen Menge? Jede Gemeinschaft hat einen Schatz geteilter Sprache und Erfahrungen, gemeinsamer Lieder, Bilder und Begeisterung. Es sind gemeinsame Codes, Formeln mit Signalcharakter und besondere Praktiken, in denen ein Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht und zum Ausdruck kommt. Und diese Verbundenheit stiftet Vertrauen. Gebetswochen der Evangelischen Allianz leben davon, dass Menschen, die einander nicht kennen, miteinander und füreinander beten. Evangelikale haben eher selten einen Sinn für Sakramente im klassischen Sinne.
Vielleicht sind Gebetsgemeinschaft und gemeinsamer Lobpreis die Sakramente des Evangelikalismus.
Hier, in den Worten eines anderen Menschen, spüren sie leibhaftig, dass Gott gegenwärtig ist.
Diese Gemeinschaftsdimension evangelikaler Frömmigkeit ist sicherlich ein Grund ihres weltweiten Erfolgs. Und genau hier liegen auch mögliche Gefährdungen. Um einige davon kurz und knapp zusammenzustellen, greife ich auf ein schlankes Modell zurück, wie es sich im Essay Über Nationalismus von George Orwell findet.[1]
Mit Nationalismus meint Orwell das Phänomen, sich mit einer Nation oder einer anderen sozialen Einheit so stark zu identifizieren, dass man keine andere Pflicht mehr anzuerkennen in der Lage ist, als ihre Interessen zu befördern. Orwells weites Verständnis von Nationalismus hat für unseren Zusammenhang zwei Stärken; er bezieht dieses Phänomen ausdrücklich nicht nur auf politische, sondern auch auf religiöse Gemeinschaften. Und er unterscheidet sorgfältig: Nicht die Liebe zur eigenen Gemeinschaft (Patriotismus) oder Überzeugung ist das Problem, sondern ihre Verabsolutierung (Nationalismus). Die problematische Überhöhung der eigenen Bewegung zeige sich an drei Merkmalen, die ich hier mit eigenen Beobachtungen auffülle: Obsession, Instabilität und Gleichgültigkeit gegenüber der Realität.
1. Obsession
Für den nationalistischen Geist ist die eigene Gruppe stets präsent. Die eigene Zugehörigkeit prägt den Umgang mit praktisch allem. In jeder Auseinandersetzung mit anderem spielen Fragen von Über- und Unterlegenheit hinein.
Es ist nie genug, dass die eigene Gemeinschaft besonders, gut oder traditionsreich ist. Stets ist sie besser. Sie ist relevanter, wahrer und zukunftsträchtiger als andere.
Kritik beruht grundsätzlich auf Verkennung. Infragestellung ist eine Aggression, die Verteidigung erfordert. Je mehr die eigene Gemeinschaft in Frage zu stehen scheint, desto wichtiger ist die kritische Abarbeitung an anderen. Im nationalistischen Verhältnis zum eigenen ist es unmöglich, sich inmitten einer Vielfalt von möglichen Wegen zu sehen. Die anderen Wege müssen als problematisch, gefährlich, gescheitert oder aussichtslos durchschaut werden.
Solche Gemeinschaften bilden das aus, was der Psychologe Irving Janis als «Gruppendenken» bezeichnet hat. Gruppenmitglieder definieren ihr Verhältnis zur Welt stark über ihr Kollektiv. Dabei ist die Gruppe stark bestimmt vom Ideal größtmöglicher innerer Übereinstimmung in allem, was als zentral gilt. Diese Erwartung macht selbstkritische Anfragen oder offene Debatten über Grundsätzliches kaum möglich. Je stärker das Gruppendenken ist, desto mehr Lagerdenken produziert es. Selbst da, wo die Gemeinschaft für andere da sein will, legt sie Wert darauf, es besser und erfolgreicher zu sein als alle anderen.
2. Instabilität
Warum reagieren manche stark von sich überzeugte Gruppen so empfindlich auf Kritik? Weil die eigene Stabilität prekärer ist, als man wahrhaben möchte. Viele extreme Phänomene zeichnen sich dadurch aus, entgegen ihrem Selbstbild oft keine besonders tiefen geschichtlichen Wurzeln zu haben. Schon darin wird deutlich: das Objekt der eigenen Verehrung (das gilt sowohl für das «Volk» wie für Formen des «wahren Glaubens») muss immer neu produziert und herausgestellt werden.
Wie stabilisiert man ein solches Gebilde? Die eine Möglichkeit ist: durch charismatische Führungsfiguren. Breite Übereinstimmung großer Gruppen ist schwer herzustellen. Am leichtesten geht es über die gemeinsame Identifikation mit einer Leitungspersönlichkeit, die das Profil und die Einheit einer Gemeinschaft verkörpert.
Charismatischer Glanz hüllt in gemeinsames Licht.
Eine solche Schlüsselfigur ist dann natürlich kaum noch kritisierbar.
Die andere Möglichkeit ist die Formulierung einer expliziten Ideologie, eindeutige Ausformulierungen, die eine glasklare Scheidung von zugehörig und nicht zugehörig ermöglichen. Solidarisierungs- und Ausschließungsaktionen sind wesentlich für das Wirgefühl.
Beide Stabilisierungsmechanismen verstärken das Gemeinschaftsgefühl. Aber sie machen es auch so schwer, diese Stärke länger als ein bis zwei Generationen lang auszuspielen. Leitungswechsel und starke geschichtliche Wandlungen können oft kaum bewältigt werden. Notwendige Veränderungsprozesse sind kaum anzustoßen.
Wer selbstkritisches Nachdenken in einer solchen Gruppe anregen will, sieht sich schnell dem Verdacht der Nestbeschmutzung und der Frage ausgesetzt, ob er noch wirklich dazu gehört.
Gerade wenn aber möglichst eindeutige Überzeugungen eine ideologische Funktion erfüllen sollen, wird man unfähig, über sie überhaupt noch zu diskutieren.
3. Gleichgültigkeit gegenüber der Realität
Jede dichte Gemeinschaft schafft sich eine eigene Welt. Das gilt für Beziehungen und Familien. Man entwickelt einen inneren Bezugsrahmen gemeinsamer Erinnerungen, witziger Anspielungen, kleiner Zeichen der Verbundenheit und des stillen Einverständnisses. Und man schafft sich so eine gemeinsame Welt, natürlich im Wissen, dass es auch andere Welten gibt.
In der problematischen Form der Gemeinschaft schafft man sich eine eigene Wirklichkeit. Um diese Realität aufrecht zu erhalten, muss sie beständig verteidigt werden gegen alles, was sie in Frage stellen könnte. Und das hat Folgen für den Umgang mit Wahrheit. Je stärker man überzeugt ist, die Wahrheit zu kennen und vertreten, desto stärker wird die Bereitschaft, dazu nicht recht passende Beobachtungen und Einwendungen zu verdrängen oder zu diskreditieren. Wahrheitsvertrauen wird ein Binnenphänomen. Die Stimmen der anderen gelten immer grundsätzlicher als unglaubwürdig. Man gewöhnt sich daran, die Selbstdarstellung immer von ihrer Wirkung und vom Erfolg her zu berechnen statt an Maßstäben der Wahrhaftigkeit.
Loyalität wird zum entscheidenden moralischen Schlüsselwert.
Wenn die Gruppe oder ihre Führung angegriffen wird, greifen archaische Muster. Der Schutz der eigenen Leute hat Vorrang vor der unbefangenen Bewertung von Streitfragen. Loyalität ist gewichtiger als Wahrheit. Loyalität befördert die Bereitschaft, die Botschaften der eigenen Gruppe zu glauben und zu verteidigen und die Unwilligkeit, ganz andere Weltbetrachtungen überhaupt noch in Betracht zu ziehen. Je stärker Kritik und Ablehnung von außen werden, desto größer wird die Solidargemeinschaft nach innen. Solche Loyalität nach innen verringert auch Empathie und Mitgefühl nach außen. Wenn es um die Identität einer Gemeinschaft geht, kennt die Ausgrenzungsbereitschaft keine Empathie mehr.
Kurz- und mittelfristig kann ein solches Verhältnis zur eigenen Gruppe diese ungeheuer erfolgreich machen. Langfristig produziert es große Probleme, wie wir in der nächsten Folge sehen werden.
[1] Auf deutsch wurde Orwells Text erstmals 2020 veröffentlicht: George Orwell (2020), Über Nationalismus. Mit einem Nachwort von Armin Nassehi, München: dtv.
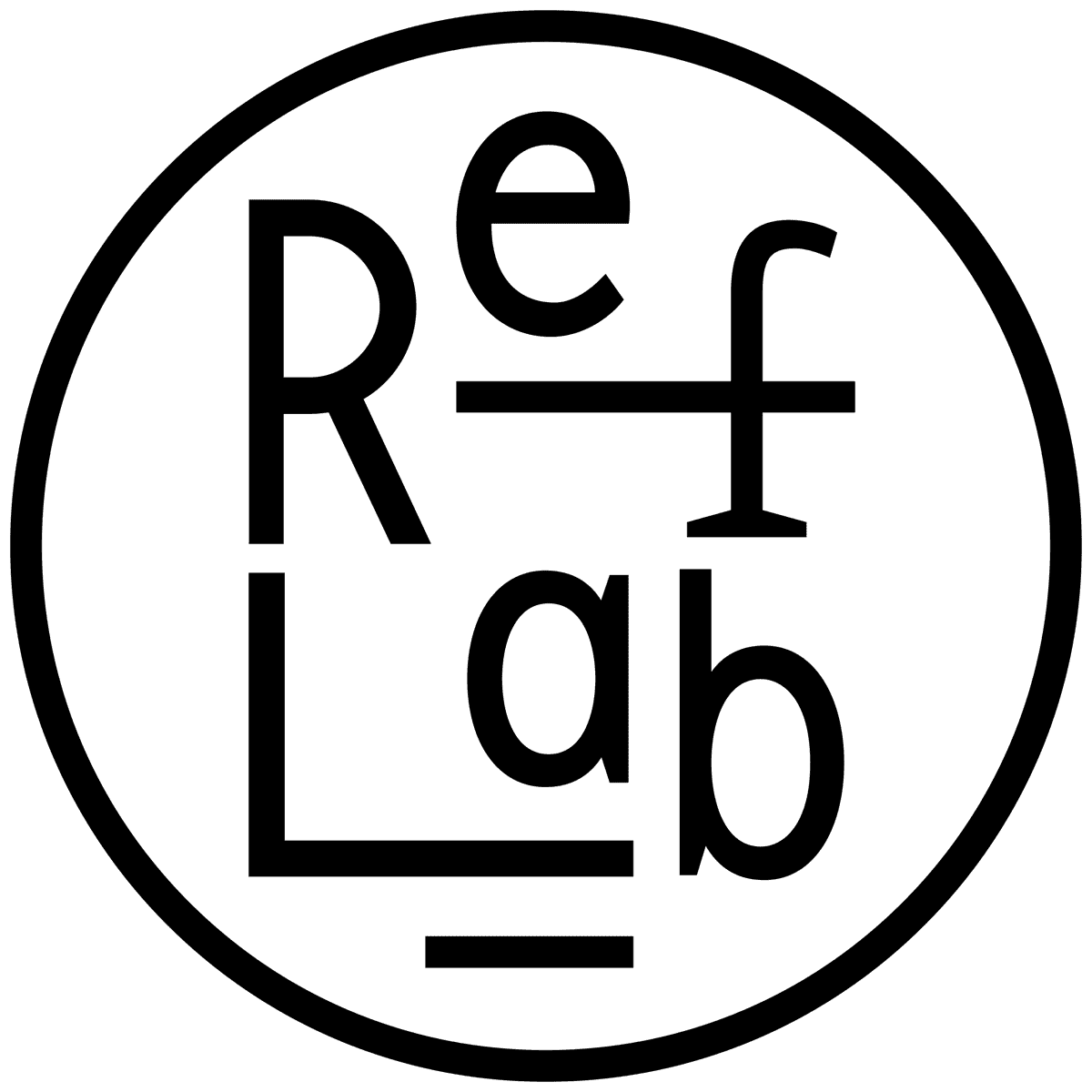








8 Gedanken zu „Gemeinschaft – Segen und Fluch“
Wieder mal ein sehr interessanter Text zu diesem wichtigen Thema, danke! Die Schriftstellerin Anne Enquist hat gerade in einem Artikel über Evangelikalismus darauf hingewiesen, dass die religiöse Subjektivität von Evangelikalen viel ungesicherter ist, als von außen wahrgenommen wird. Das sei vielen Evangelikalen selbst sehr bewusst. Doch wie geht man als Gläubiger mit Zweifel um? Das ist eine Frage, die evangelikale und nicht-evangelikale Christen eigentlich verbinden müsste. Wenn da nicht das Gruppendenken wäre… Enquist erklärt übrigens die erhöhte Missionstätigkeit von Evangelikalen aus deren Bewusstsein der Unsicherheit im Glauben.
Vielen Dank, die Beobachtung leuchtet mir sehr ein! Ich hoffe, dass es zumindest einigen Evangelikalen selbst bewusst ist, “vielen” wäre wunderbar…
Handelt es sich um Anna Enquist? Und wo hat sie diesen Text veröffentlicht?
Hmmm – ich würde zumindest die letzte Vermutung von Enquist für eine Fehleinschätzung halten. Folgen Evangelikale nicht schlicht dem Beispiel von Paulus und dem NT-Missionsauftrag?
Wo findet man diesen Artikel von A. Enquist?
Man kann es nicht besser sagen!
Danke für den Text, der auf einer theoretischen Ebene das beleuchtet, was ich hier in meiner Kirchengemeinde erlebe. Früher galt sie als Hort des württembergischen Pietismus, heute ist ihr Frömmigkeitsprofil stramm evangelikal mit viel Lobpreis, Gebetsgemeinschaft und Jesusseligkeit. Nun ist es aber so, dass diese Gemeinde seit Jahren schrumpft, in bald jeder KGR-Sitzung werden Namen verlesen von Leuten, die sich umgemeinden lassen, in Gemeinden, die ein offeneres Profil haben. Das nagt am Selbstverständnis und führt leider immer wieder zu noch mehr Klüngelei.
Obwohl ich alles andere als evangelikal geprägt bin, habe ich mich für den KGR aufstellen lassen und bin auch (als “rote Laterne”) gewählt worden. Beruflich bin ich viel in ökumenischen Kontexten unterwegs, was mir jetzt sehr hilft. Ich sehe meine Mitarbeit im KGR als eine ökumenische Challenge an. Wenn es stimmt, dass Ökumene nicht nur ein Nice-To-Have, sondern ein echter Auftrag an uns alle ist, uns in der von Gott gewollten Vielfalt anzunehmen, dann muss sich das hier bewähren. Gerade eine Ortsgemeinde bietet die Chance, andere Frömmigkeitsprofile wahrzunehmen (und hoffentlich auch irgendwann zu integrieren.)
Ich sag’s offen: das ist manchmal richtig hartes Brot. Und immer wieder ringe ich mit mir, ob ich mir da nicht zu viel zugemutet habe. Es fällt mir bei meiner Prägung schwer, bei Lobpreisliedern ein Gefühl der Beheimatung zu entwickeln. Auch theologisch sträuben sich mir immer wieder die Nackenhaare. Was mich (bisher) weitermachen lässt, ist die Tatsache, dass ich die Leute hier einfach mag und sie mir auch Wertschätzung entgegenbringen. Und eins ist auch klar: irgendwann werden wir alle hier auf dem Friedhof liegen. Wäre schön, wir könnten auch vorher schon Gemeinde sein.
Ein spannender Artikel, der aus meiner Sicht und Erfahrung das Wesentliche trifft. Die Krise steckt, wie sehr gut beschrieben, nicht einfach bei den Evangelikalen, sie steckt ja auch in der Landeskirche, wo die «Weite» (man könnte ev. auch mal etwas über «Liberalen Fundamentalismus» schreiben, der ähnliche Abwehrreflexe aufweist, wie man sie gerne bei den Evangelikalen ortet) den Menschen keine tragende Gemeinschaft bietet. Als einer, der jahrelang im Bereich Kommunikation/Werbung in der Wirtschaft gearbeitet hat, habe ich miterlebt, wie dort Vokabeln, wie Vision, Werte und Mission zu zentralen Chiffren den unternehmerischen Ausrichtung geworden sind. Sinnherstellung rutschte seit den achtziger Jahren mehr und mehr in die Arbeitswelt und ihre Strukturen. Wo kommt, wenn ich an Landeskirche denke, Freude auf? Wo könnte da noch mehr Freude und Begeisterung entstehen? Worauf basieren diese Emotionen? Wie werden sie gepflegt und entwickelt? Sogenannt Evangelikale und die Landeskirchen könnten einiges voneinander lernen – und sogar die Wirtschaft mit ihrem Dauerstruktur- und Wertewandel wäre ein guter Sparringpartner. Ein Angebot wie RefLab trifft die Themen und eröffnet dialogisch Perspektiven. So kann Kirche – toll!
Danke für diese gute Zusammenfassung!
Das spiegelt wider, was ich in der evangelikalen Welt erlebt habe:
Selbstbestätigung durch Abgrenzung und Abwertung anderer (“die Welt”, “die lauen Namenschristen” vs. “die echten, wiedergeborenen Christen”); Ausgrenzung der Fragenden und Zweifelnden, um sich selbst nicht diesen Fragen und Zweifeln stellen zu müssen; Freundschaften, die nur so lange halten, wie man in den Glaubensdogmen übereinstimmt; eine Gemeinschaft, die sich ihrer Gemeinschaft rühmt und doch so viele am Rand stehen lässt, weil sie sich nicht für den Menschen interessiert, sondern nur für den (Recht)Gläubigen.
Und Mission nicht unbedingt aus der Motivation heraus, dass man das unbedingt weitergeben möchte, was einem Frieden, Freude und Sinn schenkt, sondern weil man getrieben ist von der Vorstellung, “Verlorene retten” zu müssen (weil man sich am Ende seiner Tage vor Gott verantworten muss, wie viele Menschen man zu ihm bekehrt hat!).