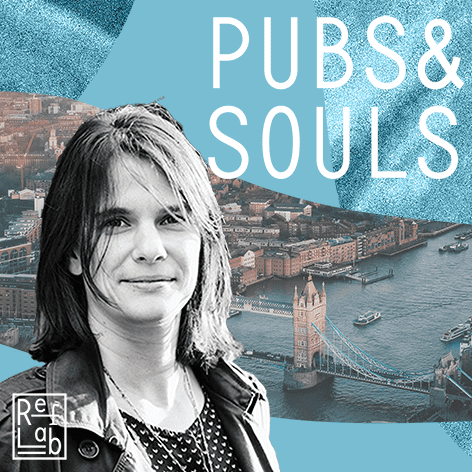Was ist ein Freund?
Eine Szene aus dem preisgekrönten Film »Good Will Hunting« (1997) wird mir immer in Erinnerung bleiben. Man findet den jugendlichen Protagonisten Will Hunting (meisterhaft dargestellt von Matt Damon) hier im Gespräch mit seinem Therapeuten Dr. Sean Maguire wieder (gespielt von Robin Williams, der für diese Rolle mit einem Oskar ausgezeichnet wurde). Sie reden über die Bedeutung und das Wesen von Freundschaften. Der rebellische Will beteuert, er habe jede Menge Freunde, mit denen er regelmäßig zum Trinken und Feiern ausgeht. Maguire blickt ihn zweifelnd an und meint (sinngemäß):
»Nein, deine Saufkumpanen und Party-Buddies sind noch keine Freunde.
Ein Freund ist jemand, der dich in Frage stellt.«
Diese Definition hat sich mir eingeprägt. Gewiss ist damit nicht jemand gemeint, der mich aus Verachtung schlechtredet, aber eben auch niemand, der mir kritiklos ergeben ist.
Ein Freund im hier von Sean Maguire beschriebenen Sinne scheint vielmehr eine Person zu sein, die mich ernst genug nimmt und der ich genügend am Herzen liege, um mir auch entschieden entgegenzustehen. Jemand, der meine Perspektive herausfordert, mir auf Augenhöhe gegenübertritt und bereit ist, mich um meiner selbst Willen aus meiner kleinen Welt herauszureißen.
Verbale Ausfälle
Es ist zu befürchten, dass die sozialen Netzwerke trotz aller Vernküpfungsleistung nicht viele Freundschaften dieser Qualität hervorbringen.
Sicher, verbale Auseinandersetzungen und Ausfälligkeiten gibt es auf Facebook, Twitter und Co. zur Genüge. Da wird geschimpft und gepoltert, verurteilt und gegenverurteilt, blockiert und entfreudet was das Zeug hält.
Dieser Widerspruch und die oft hässlichen Streitigkeiten entstehen aber meist auf den Schnittflächen verschiedener Milieus und Subkulturen, welche auf den sozialen Medien miteinander in Berührung kommen.
Wer den polemischen Tsunami der letzten Monate auf den sozialen Netzwerken etwas mitverfolgt hat, wird sich (erschreckenderweise!) nach den Fotos von Hundewelpen zurücksehnen, welche früher Facebook und Co. geflutet haben.
Im Zuge solcher Begegnungen passiert gerade nicht, was Maguire in »Good Will Hunting« als Konsequenz wahrer Freundschaft versteht: Dass Menschen sich gegenseitig weiterbringen, dass in der Interaktion mit dem Gegenüber die eigenen Standpunkte verändert, Horizonte erweitert und Argumente differenziert werden. Vielmehr werden vor den Augen der Öffentlichkeit Gesprächsfronten verhärtet, Ekelschranken hochgezogen und Vorurteile zementiert.
Echokammern
Die Dynamik sozialer Netzwerke scheint dazu zu neigen, die Welt in Freunde und Feinde aufzuteilen und die Einzelnen in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten zu beheimaten – um nicht zu sagen: einzuigeln.
Dieses Phänomen ist vor einigen Jahren unter dem Stichwort der »Filter Bubble« (auf Deutsch: Filterblase) populär geworden. Der Journalist und Internetaktivist Eli Pariser hat den Begriff in seinem gleichnamigen Buch »Filter Bubble: Wie wir im Internet entmündigt werden« geprägt und als algorithmusgesteuerte digitale Isolation des Individuums beschrieben:
Plattformen wie Google, Youtube, Facebook usw. versuchen, ihre Suchergebnisse, Videovorschläge und Feed-Beiträge auf den einzelnen Nutzer zuzuschneiden. Sie werten dazu dessen bisherige Onlinepräferenzen, seine Suchhistorie, sein Klickverhalten und Millionen andere Informationen aus, um ein immer feinkörnigeres Bedürfnisprofil des individuellen Users zu erstellen.
Das klingt (und ist) komfortabel, führt aber auch dazu, dass jeder Mensch gewissermaßen ein anderes Internet vorfindet, wenn es seinen Computer aufklappt oder seine Apps auf dem Mobilgerät startet.
Wer etwa auf einem der genannten Portale nach dem Begriff »Klimakrise« sucht, wird je nach persönlichen Interessen und politischen Neigungen unterschiedliche Ergebnisse angezeigt bekommen. Schon die automatische Ergänzung von Suchbegriffen auf Google schlägt dem einen »Klimakrise… ist eine unmittelbare Bedrohung« vor, dem anderen dagegen »Klimakrise… ist eine Lüge«.
Geldgierige Algorithmen
Diese Mechanismen sind hinlänglich bekannt. Was mir erst durch die Netflix-Dokumentation »The Social Dilemma« wirklich klar wurde, ist die perfide Logik, die hinter diesen mentalen Abschottungseffekten steht.
Eigentlich ist nämlich alles ganz einfach. Die Algorithmen der großen Social-Media-Riesen sind unzweideutig auf Gewinnmaximierung gebürstet: Der einzelne Nutzer soll so lange wie nur möglich auf seinen Bildschirm fixiert bleiben. Das gibt Facebook, Youtube und Co. die Gelegenheit, möglichst viele Werbungen zu schalten und damit möglichst viel Geld zu verdienen.
Nun funktioniert der Mensch aber erstaunlich geradlinig nach dem Prinzip der »confirmation bias«: Er möchte in dem bestätigt werden, was er ohnehin schon glaubt. Wenn er auf Videos, Texte, Memes und andere Inhalte stößt, die ihn in seinen hergebrachten Überzeugungen bekräftigen oder diese sogar noch zuspitzen, ist sein Interesse geweckt – und er liest oder schaut weiter.
Das Phänomen der Filterblasen ergibt sich also unmittelbar aus der – monetarisierten – Aufmerksamkeitsökonomie sozialer Netzwerke.
Die Algorithmen an sich sind keine moralischen Instanzen, sie verfolgen keine »bösen« Ziele. Aber die merken, dass Menschen mehr Zeit auf den sozialen Medien verbringen, wenn sie dort einmal mehr sich selbst – ihren ausgemachten Meinungen, ihren Vorurteilen und Weltanschauungen – begegnen.
Gesellschaftliche Fragmentierung
So banal die Erklärung ist, so fatal sind die gesellschaftlichen Folgen dieser Entwicklung. Man könnte auch sagen: Was für einzelne Beziehungen wahr ist – dass Medien, welche eigentlich dazu geschaffen wurden, Menschen zu verbinden und Kontakte herzustellen, dazu verkommen können, Menschen voneinander fern zu halten und Beziehungen zu erschweren – bildet sich hier gesamtgesellschaftlich noch einmal ab.
Wenn es noch eines Beweises bedurfte, dass unsere westliche Gesellschaft in unterschiedliche Stämme, Fraktionen und Milieus auseinanderzubrechen droht, dann hat die mediale Verarbeitung der Coronakrise diesen geliefert.
Auf einmal ist die Welt voller Schlafschafe, Covidioten, Diktaturanhänger und Nazi-Sympathisanten. Menschen unterschiedlicher Hintergründe und Weltanschauungen sprechen sich gegenseitig die Menschlichkeit ab und wünschen sich (ziemlich buchstäblich) die Pest an den Hals. Die scharfen Verwerfungen zwischen Menschengruppen werden wohl auch nach dem Abklingen der Pandemie noch lange nachwirken und milieuübergreifende Kommunikation erschweren.
Und auch wenn es sich bei der Tribalisierung oder Fragmentierung der Gesellschaft um ein Großphänomen handelt, das den Verunsicherungen einer globalisierten Welt erwächst und nicht einfach den digitalen Medienunternehmen in die Schuhe geschoben werden kann, so haben Facebook, Youtube, Twitter usw. diese Entwicklung doch zweifellos beschleunigt und vertieft.
Annäherungsversuche
Wie lässt sich dieser Realität entgegenwirken?
Forderungen an die Betreiber sozialer Netzwerke, den Isolationseffekt der Online-Algorithmen zu durchbrechen, mögen berechtigt sein – sie nehmen uns aber nicht aus der Verantwortung, selbst den Schritt über unsere Milieugrenzen und Meinungsgemeinschaften hinaus zu wagen.
Dazu bieten sich die sozialen Medien selbst an, gerade gegenüber Vertretern von Ideen und Überzeugungen, die ganz offensichtlich aus einen völlig anderen »Stall« kommen. Wann habe ich zum letzten Mal den Versuch gemacht (und ja, ich spreche zuerst zu mir selbst…), dem ersten Reflex zur Generalverurteilung zu widerstehen und die übliche sozial-mediale Polemik mit ernstgemeinten Rückfragen zu unterlaufen? Oder wenigstens zuerst in einer persönlichen Nachricht klären, ob es berechtigt ist, diese Person anzuprangern?
Mir ist klar, dass solche Anläufe auch zu enttäuschenden Ergebnissen führen können – manchmal legt auch die persönliche Konversation nur die tiefen Gräben zwischen den Gesprächspartnern frei. Ich habe aber doch schon erstaunliche Annäherungen und Verständigungen auf sozialen Netzwerken miterlebt; Auseinandersetzungen in den Kommentarspalten, die nicht eskaliert sind, sondern im Gegenteil zu Klärungen und Differenzierungen, sogar zu öffentlichen Entschuldigungen für vorschnelle Urteile geführt haben.
Wahre Wunder kann indes der Wechsel in die analoge Welt wirken. Die verkürzten, kontextlosen Interaktionen auf den sozialen Medien sind nun einfach von Haus aus defizitär.
Und fast immer, wenn ich dem Impuls gefolgt bin, jemanden um ein analoges Gespräch zu bitten, der mich online irritiert oder aufgeregt hat, sind daraus ausgesprochen gewinnbringende, versöhnliche Begegnungen geworden.
Nicht selten kommt dabei eben jene Dimension ins Spiel, die in »Good Will Hunting« auch als Kennzeichen von Freundschaft ausgewiesen wird.