Essgewohnheiten
In einem etablierten französischen Restaurant haben sich Beschwerden über lange Wartezeiten gehäuft. Um der Sache auf den Grund zu gehen, hat die Leitung des Gasthauses aktuelle Videoaufzeichnungen mit Aufnahmen verglichen, welche zehn Jahre zurückliegen, und sie im Blick auf die zeitlichen Abläufe minutiös analysiert.
Das Ergebnis war erstaunlich. Noch vor 10 Jahren dauerte es für die Gäste durchschnittlich 8 Minuten vom Empfang der Speisekarte bis zur Bestellung, und dann weitere 6 Minuten, bis die Vorspeise serviert wurde.
Die aktuellen Aufnahmen zeigten ein ganz anderes Bild.
Noch bevor die Gäste die Menukarte öffnen, vertiefen sich die meisten in ihre Mobilgeräte. Etwa 20% der Besucher beanspruchen die Hilfe des Servicepersonals, um die lokale WiFi-Verbindung herzustellen. Wenn der Kellner nach einigen Minuten wiederkommt, um die Bestellung aufzunehmen, haben viele die Karte noch gar nicht studiert.
Im Durschnitt geht es mehr als doppelt so lange als noch vor zehn Jahren, bis alle Gäste an einem Tisch sich für ein Essen entschieden haben. Die Zeitspanne von der Bestellung bis zum Auftischen des ersten Ganges ist dann praktisch identisch mit früheren Abläufen – nur dass jetzt über 50% der Gäste ihr Essen noch fotografieren wollen oder das Personal rufen, um ein Gruppenfoto vor dem gedeckten Tisch zu machen. Fast 25% der Kunden schicken daraufhin ihr Essen zum Aufwärmen zurück in die Küche…
Was den Restaurantbesuch in die Länge zog, war mit anderen Worten nicht die verminderte Arbeitsgeschwindigkeit der Angestellten, sondern die Zerstreuung der Aufmerksamkeit auf Seiten der Gäste.
Flüchtige Momente
Diese Geschichte – für deren Wahrheitsgehalt ich nicht bürgen möchte – hat vor einiger Zeit weite Kreise gezogen. In den sozialen Netzwerken, natürlich. Sie veranschaulicht ein weiteres Paradox, in das uns der Gebrauch von Instagram, Facebook, Pinterest und Co. hineinzieht:
Eben jene Medien und Plattformen, die dazu geschaffen wurden, um herausragende Momente zu feiern und mit anderen zu teilen, können dazu beitragen, dass uns die ungeteilte Erfahrung dieser Momente verloren geht.
Vor lauter medialem Mitteilungsbedürfnis wird dann das Essen kalt. Oder wir bringen die Nahrungsaufnahme mechanisch hinter uns, mit einer Hand ständig auf dem Handy scrollend… Das Bild eines Suppentellers, in welchen bereits ein Schlitz zur Platzierung des Mobilgerätes eingelassen wurde, hat es aufs Cover von Roberto Simanowskis Auseinandersetzung mit der »Facebook-Gesellschaft« gebracht.
Bis ins Design des Geschirrs hat sich hier die Selbstverständlichkeit eingetragen, mit welcher viele Zeitgenossen die Tätigkeit des Essens mit dem Konsum medialer Inhalte verbinden.
Nun ist das alles sicher noch kein Anlass, in einen grundsätzlichen Kulturpessimismus zu verfallen und den Untergang der Menschheit herbeizureden. Es ist aber wohl ein Grund, sich bewusst zu machen, wie fundamental die Verwertung unserer Erfahrungen auf sozialen Medien unsere Erfahrungen selbst umformt.
Gebrochene Wahrnehmung
Der italienische Philosoph Giorgio Agamben hat in den 1970er Jahren mit Blick auf die Tourismus-Fotographie festgehalten: »Im Angesicht der größten Wunder der Welt […] weigert sich die erdrückende Mehrheit der Menschheit, sie zu erfahren. Sie zieht es vor, dass der Fotoapparat sie erfährt« (Giorgio Agamben in »Kindheit und Geschichte«, 25).
Das gilt umso mehr für unsere Zeit der hochaufgelösten, in unsere Smartphones verbauten Digitalkameras: Keine denkwürdige Erfahrung, kein erstaunliches Motiv, keine Begegnung und kein Genusserlebnis ist vor der Handykamera mehr sicher.
Wer in jüngerer Zeit an einem Popkonzert war, konnte sich davon zweifellos selbst ein Bild machen. Die Band verschwindet hinter einem Meer an Handydisplays. Erhebliche Teile der Veranstaltung werden über einen wenige Zentimeter breiten Screen wahrgenommen.
Diese Wahrnehmung ist aber nicht nur verkleinert und verpixelt – sie versetzt den Wahrnehmenden in eine ganz andere Perspektive. Sie entführt ihn aus dem Moment der unmittelbaren Präsenz in die Sphären sozialer Netzwerke: Was er sieht, das sieht er jetzt für die anderen, für diejenigen, die das Video später (oder live) sehen und liken und sharen.
Verständlich also, wenn die Sängerin Adele in einem legendären Ausfall einen Konzertbesucher zurechtweist:
»Können Sie bitte aufhören, mich zu filmen? Ich bin nämlich wirklich hier! Draussen stehen hunderte von Menschen, die kein Ticket mehr gekriegt haben und die Show auf DVD schauen müssen – aber Sie sind hier drin und können mich live erleben!« (Natürlich gehört es zur paradoxen Welt der sozialen Medien, dass uns auch diese Szene nur überliefert ist, weil noch jemand anderes mit seinem Handy aufnahm und das Video online stellte…)
Verspielte Gegenwart
Roberto Simanowski, ein deutscher Literatur- und Medienwissenschaftler, befasst sich seit Jahren mit den Eigenheiten, Schlagseiten und Versprechungen der Digitalisierungsgesellschaft. Anknüpfend an die Beobachtung von Giorgio Agamben spricht er von der Gefahr der »Gegenwartsflucht« (Roberto Simanowski in »Facebook-Gesellschaft«, 40-42):
»Im Dienste künftiger Erinnerung verspielen sie schonungslos die Gegenwart und opfern die Würde des Sehens dem Willen zur Archivierung.«, beschreibt Simanowski die Teilnehmer einer Social-Media-Kultur. »Was man nicht fassen kann, das hält man fest. […] Je mehr Bilder man macht, umso weniger sieht man.«
In diesen fast schon poetischen Sätzen wird die Paradoxie, die uns in diesem Beitrag beschäftigt, auf die Spitze getrieben. Nach Simanowskis Überzeugung vernichten Facebook, Instagram und Co. die Gegenwart, gerade indem sie sie festhalten.
Durch den Gedanken an die fotografische oder videotechnische Brauchbarkeit eines Momentes schiebt sich eine zusätzliche Ebene zwischen den Menschen und seine Erfahrung. Das eigene Leben wird in einen sozial-medialen Verwertungszusammenhang gestellt – und verliert gerade so seine Unmittelbarkeit.
Achtsamkeit
Ganz sicher ist es kein Zufall, dass gerade in dieser von den sozialen Medien in Beschlag genommenen Zeit die Einübung der »Achtsamkeit« ein denkwürdiges Revival erlebt. Mindfulness-Trainer und Meditations-Seminare für Geschäftsleute, für Hausmänner (und -frauen) wie auch für Kinder schießen aus dem Boden wie Pilze nach einer regnerischen Herbstwoche. Anleitungen zur »Tee-Meditation«, Kurse mit programmatischen Titeln wie »Headspace«, »Stop, Beathe & Think« oder geradeheraus »digital detox« machen deutlich:
Es dämmert uns als Teilhaber einer Social-Media-Gesellschaft langsam, dass wir neu lernen müssen, in der Gegenwart anzukommen. Den Moment ungeteilt wahrzunehmen. Den Augenblick zu feiern. Und das alles geht irgendwie schlecht, wenn uns zugleich die Frage verfolgt, wie wir das Ganze möglichst attraktiv auf Instagram inszenieren.
(Nur am Rande sei vermerkt, dass viele Anbieter von Achtsamkeits-Angeboten eigene Apps für Smartphones anbieten, welche die Nutzer durch die Meditationen und Konzentrationsübungen führen. Und wieder grüßt die Paradoxie der digitalen Welt…)
Digitale Auszeiten
Wenigstens in den letzten Jahren wird diese Problematik auch von den Architekten sozialer Netzwerke und den Produzenten der entsprechenden Mobilgeräte anerkannt. Zwar werden deswegen nicht die Algorithmen angepasst, die unser Nutzerverhalten auswerten – sie sind noch immer kompromisslos darauf angelegt, uns möglichst lange an unseren Screens zu halten und durch gezielt eingespielte Werbungen astronomische Einnahmen zu generieren.
Sowohl Apple- wie auch Android-Mobilgeräte bieten ihren Nutzern aber neuerdings eine regelmäßige und detaillierte Analyse der »Bildschirmzeit« an. Diese Dienste bieten auch die Möglichkeit, überbeanspruchte Apps für bestimmte Zeiten gezielt zu sperren.
So kann man sich selbst sinnvolle Auszeiten auferlegen und etwa mit der nachweislich ungesunden Gewohnheit brechen, den Tag mit dem Smartphone in der Hand zu beginnen und zu beenden. Versprochen: Die damit gewonnene Zeit der Stille und Konzentration am frühen Morgen wird man nicht so schnell wieder hergeben wollen.
Und wer seine Begeisterung für ein bestimmtes Konzert, eine denkwürdige Begegnung oder eine legendäre Mahlzeit einfach nicht für sich behalten will, kann auch am Tag danach noch einige Eindrücke mit der digitalen Welt teilen (#RememberingYesterday).
Zuweilen lohnt es sich aber, höchstens seine Vorfreude auf einen Anlass öffentlich zu posten – und den Anlass selber ganz entschieden nicht sozial-medial zu verwerten.
Denn manche Momente des Lebens sind zu gut, um sie nicht einfach so zu genießen.

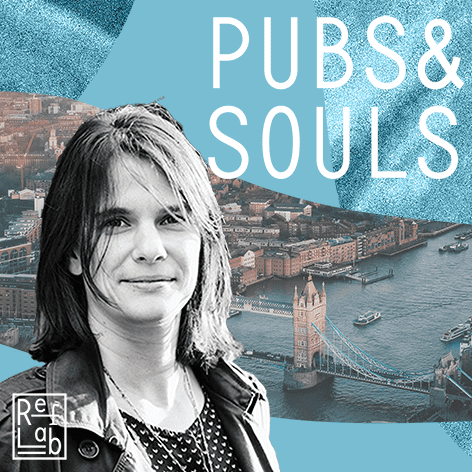






2 Kommentare zu „Die paradoxe Welt der sozialen Medien. [3] Gegenwart und Abwesenheit“
Der Realitätsverlust und seine folgen stimmen mich Nachdenklich. Letztendlich ist doch das Momentum mit all seinen Sinnen zu verinnerlichen, die Essenz des Lebens? Worauf bauen wir unsere Entscheidungen? Auf Erfahrungen, welche uns als Individuum prägten oder mit dem Ziel auf möglichst viele Likes und viraler Anerkennung? Der Verlust zum Unmittelbaren Sein, scheint für mich mit dem langsamen verschwinden der eigenen Identität einher zu gehen. Nicht heute und nicht morgen, irgendwann. Umso wichtiger finde ich es, sich den Entwicklungen bewusst zu sein und junge Generationen, aktuell Generation Z, im hier und jetzt und mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu wertschätzen.
Danke Romy für die Rückmeldung – ja, absolut! Gerade in zwischenmenschlichen Begegnungen haben wir die Chance, das Gegenüber durch ungeteilte Aufmerksamkeit ernst zu nehmen.