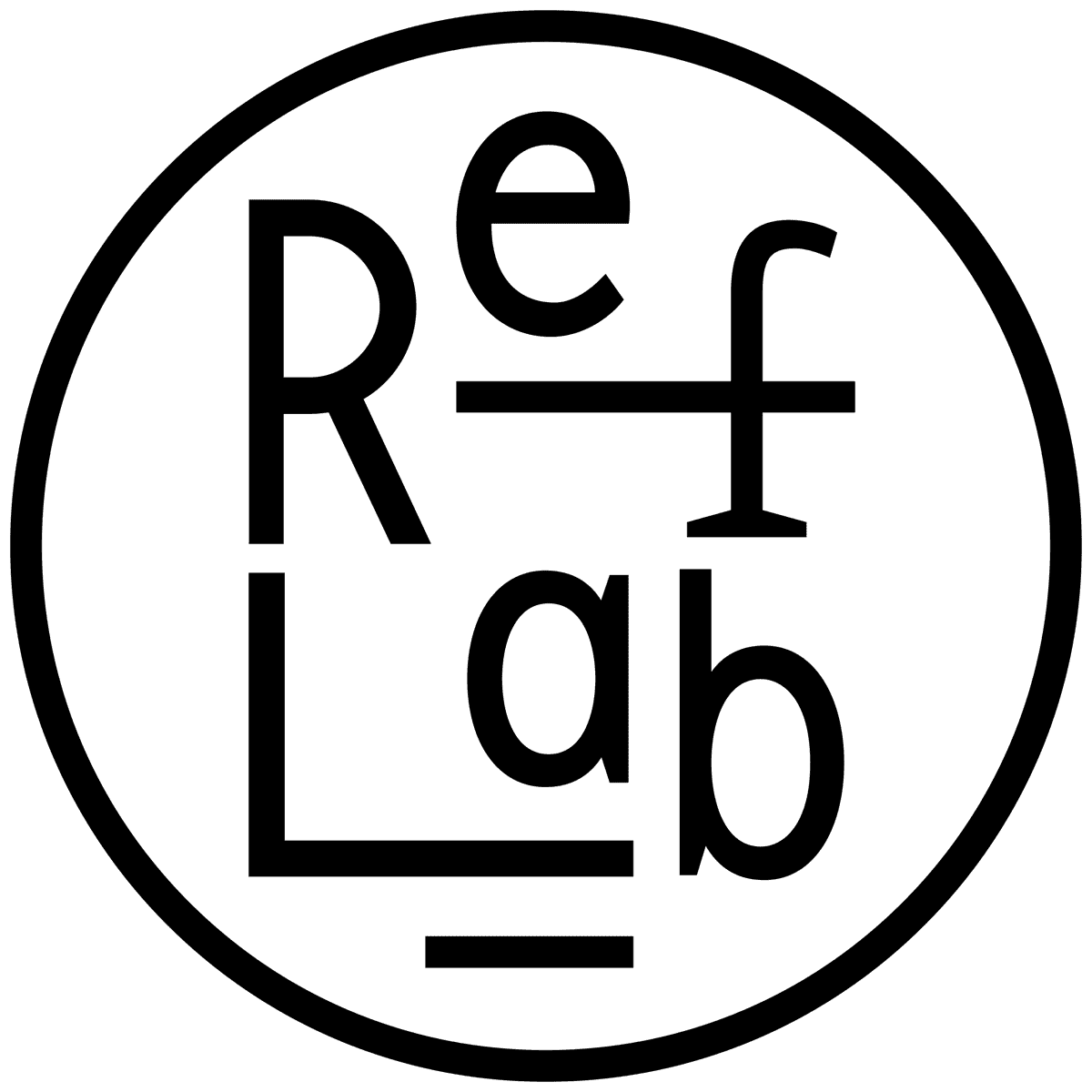Diese vierte Me(er)ditation muss ich mit einer Sehnsucht beginnen: Selbstvergessenheit. Ich trage sie in mir, weil ich das, was ich tue, immer weniger selbstverständlich, sondern ichbewusst tue, wie auf mich selbst zurückgeworfen. Vermutlich geht das angesichts der bedrohlichen Krisen erst mal auch gar nicht anders.
Kaum ein Essen, ein Einkauf, eine Fortbewegung oder eine Freizeitaktivität, ohne dass ich nicht bewusst entscheiden muss, was das mit dem Klima oder der Pandemie macht. Noch während ich spreche, höre ich mich selbst mit den vielen Ohren, von denen meine Worte nicht so gehört werden könnten, wie ich sie gemeint habe.
Mein Ich wird von aussen her immer sensibler und muss damit klarkommen. Zugleich steigt die innere Empfindsamkeit für die Momente, in denen ich selbst die Grenze des Sagbaren, des Zumutbaren überschreite. In die Würde eines anderen Menschen oder der Welt hineinzulatschen, das will ich ja umgekehrt auch nicht erleben.
Ganz schlimm wird es, wenn meine Sensibilität vor lauter Hilflosigkeit nur noch schnappen kann. Gereizt oder gar empört fordere ich dann von anderen ein, ihre Resilienz zu trainieren oder – je nach dem – sich ein wenig wokeness angedeihen zu lassen. Das Echo wird entsprechend hallen.
Wahrscheinlich hat mich meine Sehnsucht erst empfänglich gemacht für ein paar Stranderfahrungen, in denen sich das verdichtet, wonach ich mich ausstrecke.
Annähernd stoisch
«Es tut mir gut, in die Weite zu blicken, weil da nichts ist.»
Ein wunderschöner Satz. Er stammt aus Kurzinterviews, die Patricia Röttjer am Meer durchgeführt hat. Die See lockt den Blick in die Weite. Das Auge, das sich so an die Kurzdistanz von Büchern, Bildschirmen und Wänden gewöhnt hat, überquert weite Flächen, ohne länger hängenzubleiben.
Und mein Geist schweift mit. Wohin? Das darf offenbleiben, weswegen die sonst so kreisenden Gedanken unterbleiben.
Schon das ist ein erstes Loslassen meiner selbst. Weil da nichts mehr ist, das beansprucht, von mir beachtet, verstanden und geregelt zu werden. Der wohlbekannte Impuls, Messias des Moments sein zu wollen, bleibt aus. Stattdessen wohltuende Selbstrelativierung im Anblick maritimer Weiten.
In solchen Ufererfahrungen begegne ich einer Gelassenheit, die nicht erhaben über den Dingen, sondern ausgesetzt und verletzlich mittendrin steht. Jörg Zink vernimmt darin den Ruf dessen, der nach christlichem Glauben tatsächlich der Messias ist:
«Es ist viel zu tun. Ich weiß. Aber da höre ich das leise Wort: Komm! Fahr hinüber in die Stille. Versuch es: anlegen am Ufer der unhörbaren Gegenwart des Meisters. Dort zwischen den Steinen stehen, verletzlich. Einwurzeln und vielleicht erwachen wie eine Blüte. Ich weiß, viel ist zu tun. Aber nichts tun und alles geschehen lassen ist nötiger. Ist mehr.»
Fast schon hypnotisch
Besonders in den ersten Urlaubstagen schlafe ich am Strand ein, so richtig tief und fest. Die mitgeschleppte Müdigkeit geht spürbar aus den Knochen. Was mich allerdings wundert: Obwohl ich nach einer gewissen Zeit satt ausgeruht bin, döse ich immer noch regelmässig weg. Das Rauschen des Meeres wiegt mich in einem wohligen Dämmerzustand.
Die Hirnforschung liefert eine Erklärung: Wenn wir uns von Naturgeräuschen einnehmen lassen, entspannen wir innerlich. Es entsteht ein Ruhezustand, bei dem unser Gehirn allerdings äusserst aktiv ist. Sein sogenanntes «Default Mode Network» funkt in den entsprechenden Arealen ordentlich los.
Deswegen kommen mir mühelos spontane und kreative Gedanken über mich selbst, meine Lieben, Projekte oder die Zukunft. Ein Tagträumen ohne die üblichen Ängste um mich selbst. Ich kann gut verstehen, warum viele das Meeresrauschen digitalisieren, um sich jederzeit und allerorts ein wenig «hypnotisieren» zu lassen.
Sich etwas anderem hingeben und dabei selbst zu finden … der Strand bietet dazu rauschende Voraussetzungen.
Ganz schön versandet
Ein paar Tage vor der Abreise: Letzte Besorgungen. Unvermittelt gesellt sich zur Vorfreude die altbekannte Lust auf Sand. Ich dachte, ich hätte das hinter mir. Immerhin sind meine Kinder achtzehn und zwanzig Jahre alt. Es drängt mich in den Baumarkt. Da stehen sie, die kleinen, strapazierfähigen Schaufeln. Das Kaufbild im Familienchat wird frenetisch gefeiert.
Und dann haben wir geschaufelt, gebuddelt und gebaut. Sandwälle als gäbe es keinen Windschutz. Eine Sandburg, die sogar am Folgetag noch bestaunt wurde. Kanäle, um das Meer umzuleiten. Momente, Stunden, in denen ich ganz da bin, völlig hingegeben an das gemeinsame Projekt. Dass es schon bald verweht oder weggespült sein könnte, ist völlig egal.
Das Ganz-im-Element-Sein zählt, nebenzweckfrei aber äusserst sinnvoll.
Total verspielt
Es sind Tage in einem rieselnden Sandkasten voll kollektiver Spielfreude. Von allen Seiten greift sie um sich, und die Kinder tragen entscheidend dazu bei. Sie wecken das Kind in uns, selbst wenn wir Ihrem bunten Treiben einfach mal eine Weile zuschauen. Vor allem aber, wenn sie uns so in Ihre Spiele verstricken, dass wir über uns hinausgehen, ja über uns selbst zu lachen beginnen.
Nach dem Ganzkörpereinbuddeln siehst Du aus wie ein paniertes Schweineschnitzel … macht nichts. Beim Wettlauf schwabbelt was … ja und? Ohne Frisur-Crash kein Drachenfliegen … her mit dem Ding! Uups, die Wellen verulken meine Bademode … bei den anderen auch! Pommes und Softeis für die Kinder … bringt mir was mit! Papa mit dem Skimboard … super cringe, aber was soll’s!
Wie von selbst
Ich glaube mittlerweile, dass wir beim Betreten des Strandes eine imaginäre Vereinbarung miteinander unterschreiben: «Für die kommenden Stunden nehme ich mich selbst mal nicht so wichtig.»
Der Clou dabei ist: Es geschieht, ohne dass wir es merken. Anders geht’s auch gar nicht. Denn die Aufforderung «Jetzt vergiss Dich mal selbst» funktioniert genauso wenig wie die Befehle «Sei mal kreativ», «Entspann Dich» oder «Ich muss jetzt einschlafen».
Selbst in den kleinsten Erfahrungen von Selbsttranszendenz brauche ich das andere, um aus mir rausgehen zu können. Im Einlassen auf Welt und Menschen um mich lasse ich heilsam von mir selbst.
Meer davon
Dass Meer und Strand uns ohne Zwang und dann noch kollektiv aus der Reserve locken, gibt dieser Landschaft ihren Entzückungszauber.
Müssten wir derartige Orte nicht viel häufiger gemeinsam aufsuchen, um unser hyperempfindliches Miteinander durch Selbstvergessenheit zu entgiften?
Um zu erleben, dass eine grosszügige, weitherzige, spielerische, selbstheitere und gelassene Art zu leben möglich ist, bei der jede*r zutiefst bei sich selbst ankommt?
Dieser Rätselspruch Jesu hat seit Neustem eine Sommervariante. Sie lacht mir auf einer schönen Nordsee-Postkarte entgegen:
«Wir sollten insgesamt viel mehr am Meer sitzen!»