Sie waren die ersten, die Jesus nach seiner Auferstehung gesehen haben: Frauen spielten laut der Bibel rund um den Tod und die Auferstehung von Jesus eine besondere Rolle.
Schon wenige Jahrzehnte danach wurde diese Tatsache vergessen – bzw. verdrängt, wie so viele bedeutende Erzählungen der Bibel, in denen Frauen eine wichtige Rolle spielen. Weibliche Theologinnen der Neuzeit deckten diesen Misstand auf und wiesen auf grobe Fehlinterpretationen von biblischen Texten hin.
Ein zeitgemässes Christentum kann auf diese Perspektiven und ihre korrigierenden und ergänzenden Positionen nicht verzichten.
Die konkreten Potenziale feministischer Theologie sollen in diesem Artikel anhand einer Auslegeordnung mit entsprechenden Beiträgen zur Oster-Geschichte deutlich werden.
Frauen als erste Zeuginnen
Früher Morgen, das Licht der Dämmerung erhellt sanft den Garten, wo in Steinhöhlen Verstorbene zur Ruhe gebettet sind. Maria aus Magdala, eine andere Frau namens Maria oder Miriam sowie eine dritte Frau, Salome, huschen leise zu einer der Höhlen. Sie riskieren viel mit diesem geheimen nächtlichen Vorhaben.
Die Frauen besprechen, wie sie den schweren Stein zu dritt vom Eingang weg wälzen könnten, doch als sie ankommen, ist dies bereits geschehen.
Sind es die ersten leuchtenden Sonnenstrahlen, oder sitzen da tatsächlich zwei Personen in glänzenden Gewändern? Träumen sie, fragen sich die Frauen, oder erzählen ihnen die beiden tatsächlich, Jesus sei wieder unter den Lebenden? Erschrocken rennen sie aus dem Garten, da kommt er ihnen entgegen: der Auferstandene.
In allen vier Evangelien, den Büchern, die vom Leben von Jesus berichten, spielen in den Erzählungen rund um jene Tage Frauen eine grössere Rolle als in vielen anderen Texten.
- Frauen waren die ersten, die erfahren haben, dass Jesus nicht mehr im Grab liegt;
- Jesus begegnet in drei von vier Evangelien zuerst Frauen;
- Frauen erhalten den Auftrag, den Freunden von Jesus zu erzählen, dass er auferstanden ist, und diese erstaunliche Botschaft zu verbreiten.
In Anbetracht der Tatsache, dass es sich hier um das Kernereignis des Christentums handelt, fällt das auf.
Kein Zufall!
Es sind nicht die zwölf bzw. dort noch elf Kern-Jünger, denen der Auferstandene zuerst erscheint. Es sind aber auch keine Zufallsbegegnungen: Jesus begegnet Frauen, die namentlich genannt werden (diese Aufzählung unterscheidet sich in den Erzählungen leicht, Maria Magdalena ist aber immer dabei).
Was bedeutet es, dass Frauen hier eine zentrale Rolle spielen?
Es ist nur konsequent: Jesus, der sich während seiner prophetischen Tätigkeit immer der gewöhnlichen Bevölkerung oder sogar den Menschen am Rand der Gesellschaft zuwandte, erscheint nicht den «Wichtigen» zuerst.
Vielmehr wird die Umkehrung von Hierarchien, die Jesus propagierte, hier exemplarisch inszeniert.
Potenziale feministischer Theologie – kurz zusammengefasst
Dieser transformativen Botschaft widmet die feministische Theologie ihr Haupt-Augenmerk. An diesem Beispiel lässt sich deswegen gut ablesen, welche Potenziale diese Perspektive hat:
- Feministische Theologie deckt ganz spezifische Aspekte biblischer Texte auf, die in der traditionellen Theologie unterbelichtet oder sogar fehlerhaft überliefert wurden. So trägt sie zu einer genaueren, wissenschaftlich redlicheren Theologie bei.
- Sie betont die Wichtigkeit des Einsatzes für Gerechtigkeit gegenüber marginalisierten und ausgebeuteten Menschen. Dies tun sie in Anknüpfung an die ursprüngliche, befreiende Botschaft von Jesus Christus. Eine aufrichtige Christus-Nachfolge nimmt diesen zentralen Aspekt ernst.
- Sie erlaubt diversere und damit ganzheitlichere Gottesbilder. Dies ist für die individuelle Spiritualität zuträglich. Oder anders gesagt: Dass Gott nicht der alte, weisse Mann auf dem Thron ist, ist inzwischen klar. Aber was ist Gott dann? Unterschiedliche theologische Perspektiven beleuchten – biblisch fundiert – andere Erscheinungs- und Beschreibungsweisen Gottes, etwa die vielen Stellen im Alten Testament, in denen Gott in weiblichen und mütterlichen Bildern geschildert wird.
Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit, Vertrauen – warum diese Anliegen in Theologie und Kirche nicht breit rezipiert wurden, erschliesst sich auf den ersten Blick nicht.
Doch die feministische Theologie ist bis heute nicht unumstritten oder wird schlicht belächelt. Das hat verschiedene Gründe.
Umstrittene theologische Strömung
1. Reizwort «Feminismus»
Zum einen ist der Begriff «Feminismus» für viele ein Reizwort. Assoziiert werden damit etwa Männerhass, eine politische Ideologie, Abwertung von Mütterlichkeit und Weiblichkeit. Wie bei vielen Strömungen werden die Extreme als repräsentativ wahrgenommen.
Dabei bedeutet Feminismus heute nicht mehr nur der Einsatz für die Gleichstellung von Frauen. Und es geht auch nicht um erfundene oder unwichtige Probleme.
Vielmehr setzt sich Feminismus für alle Menschen ein, die in einer auf weisse, gebildete, heterosexuelle und gesunde Männer ausgerichteten Gesellschaft benachteiligt sind.
Denn die zugrundeliegenden Probleme sind vielschichtig. So schreibt die Theologin Silvia Schroer: «Patriarchat möchte ich im differenzierten Sinn als komplexes Herrschaftssystem verstanden wissen (…), in dem bestimmte Männer, aber auch Frauen bestimmter Klassen oder Gruppen über andere Männer, Frauen, Kinder Herrschaft ausüben.» (Schottroff/Schroer/Wacker 1995, 88.)
Feminismus ist also von einem tiefen Gerechtigkeits-Anspruch geprägt.
Wenn dies als störend oder provokativ aufgefasst wird, ist dies auch ein Zeichen dafür, wie tief ungerechte und ausbeuterische Strukturen verankert sind.
2. Perspektivität als Nachteil
Universitäre Theolog:innen pflegen bis heute oft das Selbstbild, «neutral» und «objektiv» zu sein.
Kontextuellen Theologien wie der feministischen, aber auch der queeren, Befreiungs-, postkolonialen oder Theologie der Behinderung wird deswegen Partikularität oder ein ideologischer Fokus vorgeworfen.
Dass natürlich auch mitteleuropäische Männer eine spezifische Perspektive auf die Welt hatten und Theologie entsprechend prägten, wird ausgeblendet. (Video: «Es gibt keine objektive Theologie»)
3. Kritik von biblizistischer Seite
Historisch ist die feministische Theologie im liberalen Feld anzusiedeln. Deshalb wird sie auch von Christ:innen, die sich eher konservativ, pietistisch oder evangelikal orientieren, skeptisch beäugt.
Dies liegt zum einen an der historisch-kritischen Exegese. Diese bildet die Basis einer feministischen Bibelauslegung.
Denn gerade mit einem Blick auf soziale Fragen ist es wichtig, die Texte in ihrem historischen Kontext zu verstehen.
Zum anderen vernetzt sich die feministische Theologie natürlich mit anderen feministischen Perspektiven. Einige derer Kernanliegen sind konservativeren Christ:innen nach wie vor ein Dorn im Auge – etwa das Recht auf körperliche und sexuelle Selbstbestimmung.
4. Unbequem und kirchenkritisch
Ein zentraler Punkt, warum feministische Theologie unbequem ist, ist aber: Sie setzt sich für die Aufdeckung von ungerechten Machtstrukturen ein – auch in der Kirche.
Sie entlarvt, wie biblische Texte eingesetzt wurden, um Menschen klein zu halten. Mit diesem Hintergrund ist sie immer wieder sehr kirchenkritisch.
Die bekannte Theologin Elisabeth Schüssler Fiorenza sprach sogar vom «Kyriarchat»; ein Begriff, mit dem sie spezifisch kirchliche patriarchale Machtstrukturen bezeichnete. [3]
Wie einige Beispiele zeigen, gehen diese bis in die ersten Jahrhunderte zurück.
Frauen glaubt man nicht
Als die Frauen vom Grab zurück zu den elf Kern-Jüngern gingen, glaubten ihnen diese nicht – auch das steht in den Evangelien. Oft wird dies ihrem Geschlecht zugeschrieben, denn es gehört auch heute zu grundlegenden Erfahrungen von Frauen, dass ihnen weniger geglaubt wird als Männern.
Es gibt jedoch auch männliche Zeugen, denen die Jünger nicht glaubten (Markus 16,12). Überzeugender ist – auch deswegen – die Ansicht mancher Theolog:innen, die das Unglauben so deuten, dass eine Totenauferweckung schlicht als unmöglich gesehen wird und wurde.
Jörg Frey: «(Die Auferstehung) war nicht Teil des religiösen Verstehensrepertoires der palästinensischen Zeitgenossen Jesu.» (Frey 2018, 330.)
Jedoch gibt es viele andere Hinweise darauf, auch in der Bibel, dass die von Jesus praktizierte Gleichstellung von Frauen (und anderen marginalisierten Menschen) von der Kirche nicht genügend ernst genommen wurde.
Frauen als Apostelinnen: ein Problem für Kirchenmänner
Paulus etwa legitimiert seine Apostolizität, seinen Titel als «Apostel», als «Gesandter», damit, dass er den Auferstandenen gesehen hat. Bis heute ist diese Selbstbezeichnung bei ihm unbestritten.
Den Frauen, die Jesus als erste wieder lebend sahen und von ihm sogar den Auftrag erhielten, die Auferstehungs-Botschaft zu verbreiten, wurde dieser Titel hingegen nicht zugestanden bzw. sogar aktiv aberkannt.
Paulus lässt in seinem eigenen Bekenntnis in 1. Korinther 15,3-6 die Zeuginnen der Auferstehung weg: Er erwähnt darin nur Petrus und die Zwölf, denen Jesus zuerst erschienen sei.
Das bekannteste Beispiel für diese aktive Negierung von bedeutenden Frauen im Christentum ist jedoch eine dreiste Umschreibung der Bibel:
Einer Frau namens Junia, die im Römerbrief als «angesehen unter den Aposteln» bezeichnet wird, wurde in einen Mann (den fiktiven «Junias») umbenannt, wie die Theologin Bernadette Brooten 1977 nachweisen konnte.
Die Diskreditierung von Maria Magdalena
Auch Maria Magdalena, die in den Auferstehungsberichten eine zentrale Rolle spielt, wurde von einflussreichen Kirchenmännern immer wieder diskreditiert. Dies, obwohl sie in der frühen Kirche als wichtig angesehen wurde.
Es gab einen nachbiblischen Text, ein sogenanntes «Maria-Evangelium», das sie im Diskurs mit Petrus und den anderen Jüngern beschreibt. Viele Abschriften davon wurden absichtlich zerstört.
Und Papst Gregor I. stellte Magdalena im 6. Jahrhundert mit der unbekannten «Sünderin» aus Lukas 7, 36ff gleich, wodurch sie als Prostituierte gelabelt wurde. Dies ist gleich doppelt falsch: Erstens ist die Übereinstimmung der Personen nicht biblisch nachweisbar, zweitens steht im biblischen Text kein Wort dazu, welcher Tat die «Sünderin» schuldig geworden war.
Während die Geschichte Gottes auch rund um die Auferstehung Jesu bekräftigte, dass Frauen und Männer gleichwertig sind, ging die Kirche also immer wieder zurück zu gesellschaftlichen Hierarchien.
Dies ist nicht nur bei der Frage nach Gender so: In der gesamten Bibel gibt es etwa starke Argumente gegen die Sklaverei, dennoch galt sie auch innerhalb des Christentums extrem lange als legitim.
Die Botschaft von Jesus richtete sich gegen jegliche Form der Ungerechtigkeit. Dennoch baut die Kirche bis heute auf ungerechten Machtstrukturen auf und kolportiert diese an diversen Stellen weiter.
Karfreitag und Ostern im Fokus feministischer Theologie
Die feministische Theologie nahm im 20. und 21. Jahrhundert viele dieser Misstände in den Fokus. Viele Theologinnen deuteten in diesem Zuge auch die Auferstehung neu.
Sie störten sich, wenn nicht am Kreuz, dann an der theologischen Fokussierung darauf. Regula Strobel schrieb von der «nekrophilen Kultur des Christentums» und einem damit einhergehenden sadistischen Gottesbild.
Vor allem aber kritisierten Strobel und andere scharf, dass die Selbstaufopferung Jesu als Vorbild für alle Menschen propagiert wurde. Unter Verweis darauf forderten Mächtige von Frauen und anderen nicht-privilegierten Menschen in den letzten zwei Jahrtausenden unendlich viel Verzicht, kostenlose Arbeit, Unterordnung. Mächtige Männer nutzten den Topos der Selbsthingabe Jesu, um Gewalt zu legitimieren, andere auszubeuten und selber zu profitieren.
Nach Überzeugung feministischer Theologinnen befördert die Fixierung auf das Kreuz aber auch eine individualistische Auffassung der Erlösung.
Die Gefahr ist, dass die Erlösung nicht mit einer konkreten befreienden Praxis verbunden wird, wie sie Jesus gelehrt hatte.
Viele feministische Theologinnen weisen auf die Tätigkeit von Jesus vor seinem Tod hin: Wie er Menschen heilte, aufrichtete, sich für Gerechtigkeit und Gleichheit aller einsetzte. Wie er von einem «Leben in Fülle» sprach.
Die Auferstehungsbotschaft der Frauen interpretierten sie als Weiterführung dieser Tätigkeit. Das leere Grab, so Strobel, postulierte Jesus als Lebendigen: Er ist nicht mehr unter der Erde, sondern auf der Erde – und zwar in all jenen, die in seinem Namen für Würde und Gerechtigkeit kämpften. Nicht zwingend sei Jesus als Person auferstanden, sondern seine Botschaft lebe in seinen Nachfolger:innen fort.
Ein neues Ungleichgewicht
Elisabeth Moltmann-Wendel wies darauf hin, dass damit ein neues Ungleichgewicht entstand. Sie schreibt sogar, es sei in der «Frauenkirche» eifrig darübergewacht worden, «dass keine individuelle heile Spiritualität den Kampf gegen die Strukturen verwischte.» Dabei mache die Fokussierung auf eine jesuanische Ethik Erlösung zu einer menschlichen Aufgabe – einer zu grossen.
Sie setzte sich für eine feministische Theologie ein, die beides im Blick hat: den Kampf gegen Ungerechtigkeit und die Förderung einer individuellen Spiritualität von Frauen.
Denn das Evangelium, die frohe Botschaft, die Jesus in die Welt brachte, bestehe sowohl aus seiner gelebten Tätigkeit als auch aus seinem Tod und Auferweckung.
Jesus erlitt das brutale Schicksal unzähliger Menschen, die für ihren Einsatz gegen Ungerechtigkeit hingerichtete werden und wurden. Diese Auffassung des solidarischen Leidens war für die Befreiungstheologie wichtig und gibt Menschen bis heute Kraft.
Anders als alle anderen überwand Jesus aber den Tod. Nicht nur das leere Grab, sondern vor allem die Begegnung mit dem Auferstandenen bekräftigt deswegen die Wahrheit, dass die Kraft Gottes neues Leben schafft.
«Frau, warum weinst du?»
Diese Wahrheit, diese Hoffnung ist es, was Christ:innen immer getragen hat. Das Versprechen, dass Gott eines Tages alle Ungerechtigkeit beseitigen und alle Tränen abwischen wird.
Dass diese Hoffnung die Realität nicht verleugnet, zeigt sich in einer der Osterbegegnungen, die in der Bibel erzählt werden (im Johannesevangelium, Kapitel 20):
Maria Magdalena hat entdeckt, dass Jesus aus dem Grab verschwunden ist. Während die anderen Jünger, die sie dazugeholt hatte, schon wieder weg sind, bleibt sie dort stehen. Sie weiss nicht, wohin.
Plötzlich ist Maria nicht mehr alleine. Zuerst sitzen zwei Engel beim Grab, dann steht ein Mann hinter ihr, den sie zuerst nicht erkennt. Alle drei fragen sie:
«Frau, warum weinst du?»
Jesus nimmt ernst, was Maria beschäftigt. Er sieht ihre Liebe, ihren Mut, das Vertrauen, das sie in ihn hatte, und wendet sich ihr zu.
Die Auferstehung bekräftigt nicht nur den Auftrag von Jesus, dass wir Menschen uns einander zuwenden sollen. Sondern sie bestätigt die zentrale Botschaft der Bibel, dass Gott sich den Menschen zuwendet.
Wen biblische und heutige Frauen-Geschichten interessieren, der sei dieses Buch empfohlen: Mira Ungewitter: «Gott ist Feministin» (Herder, 2023)
Zwei Theologinnen betreiben den Podcast «Feministische Bibelgespräche».
RefLab-Serie «Briefe an Frauen der Bibel»
Einige der genannten Ansätze zur Auferstehung vertieft Thorsten Dietz bei Fokus Theologie im Artikel: «Welchen Sinn hat die Auferstehung heute?»
Bild: Frank Flores, Unsplash
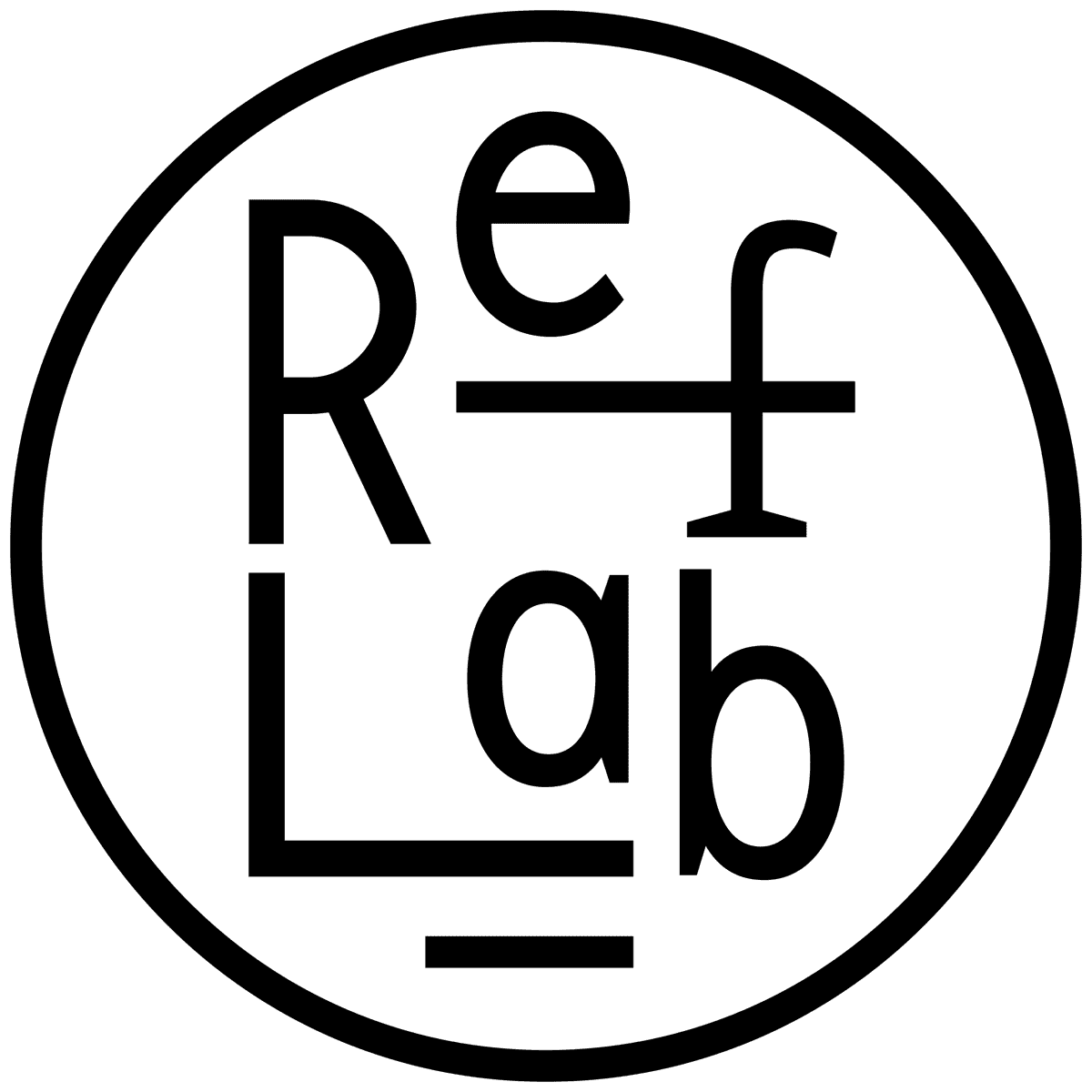









6 Gedanken zu „Die Frauen am Grab“
Thanks for the excellent and thoughtful article.
This is so important to know, digest and share.
Spannend ist ja die Spannung zu 1. Kor. 15, wo Petrus schon bei Paulus in geprägter Form in einem Bekenntnis als erster Osterzeuge genannt wird. Aber kann das sein, das jemand später erfunden hat, dass eine Frau, nämlich Maria Magdalena, eigentlich die erste Zeugin war? Dafür spricht ja einiges, selbst wenn man das “leere Grab” für eine späte Tradition hält. Oder ist es nicht viel eher so, dass in der patriachalen Gesellschaft auch der ersten Christen als Zeuge am Anfang nur ein Mann genannt werden konnte? Sogar Lukas, der anscheinend gar Erlebnis von Petrus am Ostermorgen erzählen kann, legt noch Wert darauf, dass vor den Frauen Patrus sein Ostererlebnis hatte.
Das finde ich auch eine wichtige Frage, die einen Blick auf die jahrhunderte alte Tadition wirft, in der männliche Erfahrungen und Strukturen wichtiger waren als die von Frauen.
Ganz toller Artikel, dem ich mich als liberaler, feministisch- befreiungstheologisch geprägter Theologe und Pfarrer nur anschliessen kann! Da kann ich auch als Mann mit gehen, danke! Die feministische Perspektive auf biblische Texte finde ich enorm inspirierend und befreiend! Weiterso und ich klau’ das natürlich mal wieder für ne Predigt!
Lieber Roland, danke für das schöne Feedback!
Ich hatte mich kürzlich gefragt, wie die Bibel wohl aussehen würde, wäre sie von Frauen geschrieben worden?
Interessant, was KI dazu gesagt hatte, als ich diese Frage Chat-GTP stellte:
‘Es ist schwer zu sagen, welche Themen in der Bibel angesprochen worden wären, wenn sie ausschliesslich von Frauen geschrieben worden wäre. Da die Bibel jedoch ein Buch ist, das die religiösen und kulturellen Überzeugungen seiner Zeit widerspiegelt, könnte man vermuten, dass die Themen, die in einer solchen Bibel angesprochen würden, eng mit den Erfahrungen und Perspektiven von Frauen verbunden wären. Einige der Themen, die in einer solchen Bibel behandelt werden könnten, könnten sein:
Frauenrechte und Gleichberechtigung: Frauen könnten ihre eigenen Erfahrungen mit Diskriminierung und Unterdrückung beschreiben und die Bedeutung von Frauenrechten und Gleichberechtigung betonen.
Weibliche Spiritualität und Gottesbild: Frauen könnten ihre eigenen Vorstellungen von Gott und Spiritualität darlegen und auf die Rolle von Frauen in der religiösen Gemeinschaft eingehen.
Familien- und Gemeinschaftsleben: Frauen könnten die Bedeutung von Familien- und Gemeinschaftsleben betonen und auf die Herausforderungen eingehen, die mit diesen Rollen verbunden sind.
Liebe, Beziehungen und Sexualität: Frauen könnten über ihre eigenen Erfahrungen und Perspektiven in Bezug auf Liebe, Beziehungen und Sexualität sprechen und auf die Bedeutung von Respekt und Einverständnis hinweisen.
Natur und Umwelt: Frauen könnten die Natur und Umwelt als spirituelle und heilige Bereiche betrachten und auf die Bedeutung des Schutzes und der Bewahrung dieser Bereiche hinweisen’.
Ermutigend sind auch die die vielen Aufbrüche, Theologie neu zu denken.
Chat GTP sagt dazu:
‘Interreligiöser Dialog: Die theologische Forschung und der Dialog zwischen verschiedenen religiösen Traditionen und Glaubensrichtungen sind wichtige Themen. Theologen setzen sich vermehrt mit den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den Weltreligionen auseinander und suchen nach Möglichkeiten zur Förderung des interreligiösen Verständnisses und der Zusammenarbeit.
Feministische Theologie: Feministische Theologie hat in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen. Sie untersucht die Rolle von Frauen in der Religion, die Geschlechterdynamiken innerhalb religiöser Institutionen und die Interpretation religiöser Texte aus einer geschlechtsspezifischen Perspektive.
Ökologische Theologie: Angesichts der globalen Umweltkrise beschäftigen sich immer mehr Theologen mit Fragen der Umweltethik und der Verantwortung des Menschen für die Schöpfung. Ökologische Theologie erforscht die religiösen Dimensionen des Umweltschutzes und Nachhaltigkeit.
Postkoloniale Theologie: Postkoloniale Theologie setzt sich mit den Auswirkungen des Kolonialismus auf religiöse Denkweisen und Praktiken auseinander. Sie hinterfragt die Kolonialisierung des Glaubens und sucht nach Befreiung und Gerechtigkeit in postkolonialen Kontexten.
Dialog zwischen Theologie und Wissenschaft: Die Beziehung zwischen Theologie und Wissenschaft ist ein wichtiger Diskussionspunkt. Theologen erforschen Themen wie Evolution, Neurowissenschaften und Künstliche Intelligenz, um die theologischen Implikationen dieser Entwicklungen zu verstehen.
Soziale Gerechtigkeit: Theologie und Ethik sind eng mit Fragen der sozialen Gerechtigkeit verknüpft. Theologen setzen sich mit Themen wie Armut, Rassismus, Migration und anderen sozialen Ungerechtigkeiten auseinander und suchen nach theologisch fundierten Lösungen.
Religiöse Vielfalt und Säkularisierung: In einer zunehmend pluralistischen und säkularen Welt setzen sich Theologen mit den Herausforderungen und Chancen der religiösen Vielfalt und der Säkularisierung auseinander’.
Ob sich die Kirche, insbesondere die römisch-katholische, diesen Aufbrüchen zu stellen vermag, bezweifle ich. Ich halte diese Kirche leider für nicht-reformierbar, trotz der unglaublich guten Arbeit des kürzlich verstorbenen Papst Franziskus. Es macht aber nichts, wenn diese patriarchale Männerkirche bald untergeht, resp. in der Bedeutungslosigkeit versinkt. Die Bibel verheisst: Siehe, ich mache alles neu!
Lieber Beat, danke fürs Weiterdenken. Das erscheint mir alles relativ logisch – und gleichzeitig drängt sich die Frage auf, warum Themen wie Gerechtigkeit, Vielfalt, Ökologie in der «Männerkirche» (sag ich jetzt mal sehr stark vereinfacht) keine Rolle spielen, obwohl sie überhaupt nicht genderbezogen sind…?