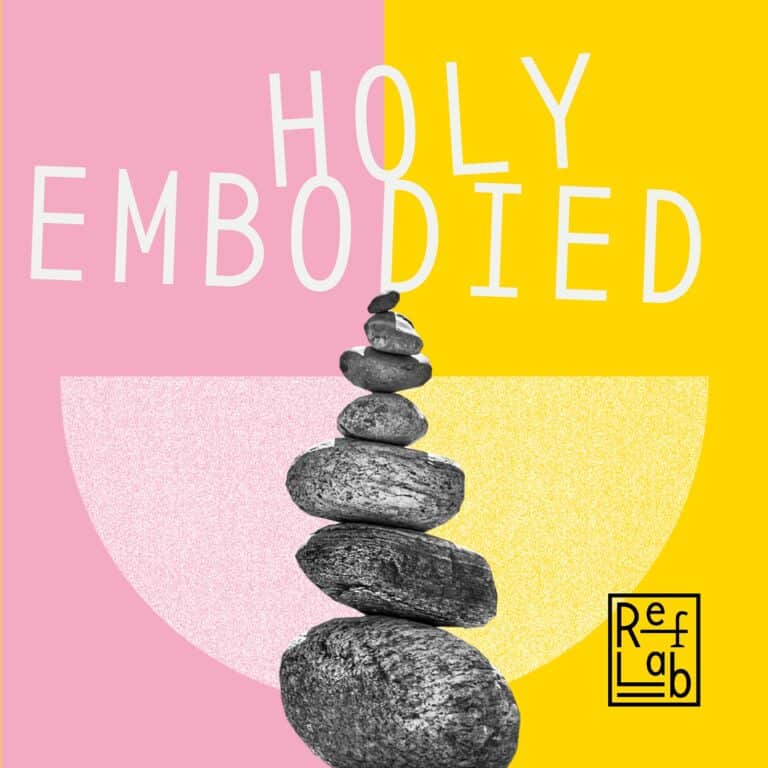Verpasster Zauber
Das Experiment fand vor einigen Jahren in einer U-Bahn-Station in Washington statt. Es wird von der renommierten Zeitung »Washington Post« begleitet und soll die Wahrnehmungsfähigkeit von Menschen mitten im Alltag untersuchen. Die Idee ist einfach. Man stellt einen Violinisten an den Eingang der Haltestelle und lässt ihn während der Rush Hour spielen.
Nur ist es nicht irgendein Geigenspieler, sondern kein Geringerer als der weltberühmte und gefeierte Violinist Joshua Bell. Er gilt von klein auf als Wunderkind, spielt schon früh die komplexesten klassischen Kompositionen und füllt bald die größten Konzertsäle der Welt. Führende Konzertmusiker haben ihn vor dem Experiment gewarnt, weil sie einen unkontrollierbaren Menschenauflauf befürchtet haben. Aber Bell war zu neugierig, um abzusagen.
Und so packt er an diesem Tag seine Stradivari aus – ein Instrument, das 1730 gebaut wurde und dessen Wert auf etwa 3.5 Millionen Dollar geschätzt wird –, und beginnt zu spielen. Es gibt ein Video, das im Zeitraffer die 45 Minuten zusammenfasst, in denen Joshua Bell acht Stücke von Johann Sebastian Bach zum Besten gibt. In diesem Zeitraum betreten 1‘097 Leute diese U-Bahn-Station. Und sie laufen stracks… an ihm vorbei. Niemand nimmt Notiz. Kein Einziger applaudiert. Nur sechs Leute halten überhaupt an, um einige Sekunden länger zuzuhören, und 20 Leute werfen ihm etwas in den Geigenkasten, ohne ihren Schritt zu verlangsamen. Es kommen gerade mal 12 Dollar und 37 Cent zusammen.
Was passiert, wenn einer der begabtesten Violinisten der Welt auf einer der besten Geigen, die je gebaut wurden, einige der schönsten klassischen Stücke der Musikgeschichte spielt – im Werktagsbetrieb einer U-Bahn-Station? Antwort: Gar nichts. Die Klänge eines weltberühmten Musikers erfüllen den Raum, aber keiner hört wirklich zu.
Wertgeschätzter Augenblick
Wir setzen uns in dieser Beitragsreihe mit der Unberechenbarkeit des modernen Lebens auseinander. Die Pandemie-Krise unserer Tage hat der Welt in aller Deutlichkeit vor Augen geführt, was eigentlich schon vorher nur schwer zu bestreiten war: Unser hochentwickeltes und vernetztes Leben ganz besonders in den westlichen Wohlstandsgesellschaften bewegt sich auf dünnem Eis. Unabsehbare (oder zumindest unerwartete) Ereignisse können das sensible Gleichgewicht erschüttern und ökonomische, ökologische oder soziopolitische Abgründe aufreißen.
Was also gibt das berühmt gewordene Experiment der Washington Post für unser Thema her? Zunächst einfach dies: Wenn wir nicht absehen können, was morgen auf uns zukommt, wenn wir als Teilnehmer einer Risikogesellschaft jederzeit von der Unberechenbarkeit unserer Existenz eingeholt werden können, dann gewinnt der Moment, in dem wir gerade jetzt leben, umso mehr Bedeutung. Das millionenfach angeschaute Video, welches Joshua Bell und die vorbeilaufenden Menschenmassen dokumentiert, trägt dann auch den Titel »Stop and hear the music«.
Wenn morgen die Finanzmärkte einbrechen, ein Erdbeben die Welt erschüttern, ein neuartiges Virus sich ausbreiten oder eine kriegerische Auseinandersetzung beginnen könnte… dann haben wir umso mehr Grund, heute der Musik zu lauschen, die Freunde zu umarmen (wenigstens außerhalb von Pandemiezeiten…), an der Rose zu riechen, dem Partner wirklich zuzuhören, den Sonnenuntergang zu beobachten – oder auch einfach unsere Arbeit bewusst und herzhaft zu tun.
Gerade die Wagnishaftigkeit des Lebens gibt uns Anlass, den Augenblick wertzuschätzen und den Zauber des Alltäglichen zu feiern.
Abgelenkte Moderne
Und just an diesem Punkt scheint unsere Zeit zu kranken. Wir leben in einer denkwürdig und fragwürdig beschleunigten Gesellschaft, wie etwa der Soziologe Hartmut Rosa unermüdlich in Erinnerung ruft. Und das ist mehr als ein bloß subjektives Lebensgefühl. Das lässt sich sogar messen.
Seit längerem wird in verschiedenen Großstädten dieser Welt etwa die Laufgeschwindigkeit der Passanten aufgezeichnet: Wie schnell sind Menschen auf den Einkaufsmeilen von Berlin, London, Tokyo oder Zürich unterwegs? Es dürfte die Wenigsten überraschen, dass die Schrittfrequenz auf den Straßen der urbanen Zentren in den vergangenen beiden Jahrzehnten ebenso signifikant zugenommen hat, wie die Dauer der sogenannten »Hupsekunde« geschrumpft ist: Damit wird die Zeitspanne bezeichnet zwischen dem Wechseln einer Verkehrsampel auf grün und dem ersten Hupen eines Verkehrsteilnehmers, falls das vorderste Auto nicht losfährt.
Die Schweiz und Deutschland gehören in diesen Statistiken neben Japan übrigens zu den weltweiten top drei.
Wir sind schnell unterwegs, wir wollen keine Zeit verlieren. Wir meinen so viel zu erledigen zu haben, dass sich jede ungenutzte Sekunde als Verlust an produktiver Lebenszeit anfühlt. Und wer uns an der Verkehrsampel, in der Arztpraxis, an der Bushaltestelle oder in der Schlange vor der Supermarktkasse warten lässt, macht sich des Diebstahls unserer wertvollsten Ressource schuldig.
Ausgefüllte Pausen
Kein Wunder also, dass der rasante technische Fortschritt unserer Tage wesentlich dazu dienen muss, die Leerzeiten unseres Lebens auszufüllen und ungenutzte Momente strategisch auszumerzen.
Das Stillstehen an der roten Ampel, das Warten auf die Straßenbahn, die Zeit im Wartezimmer vor der Sprechstunde, das Innehalten beim Essen, die Minuten, die wir auf dem Klo verbringen: Sie alle kennzeichnen Situationen, in denen uns das Leben einen Moment der Ruhe zumutet, einen Moment »dazwischen«. Meistens sind es unfreiwillige, durch Umstände oder Notwendigkeiten auferlegte Zeiträume, in denen keiner etwas von uns will, in denen wir mit unseren Vorhaben nicht weiterkommen und auf »Pause« stehen.
Jeder kennt sie. Denn auch die gestressteste Geschäftsfrau muss mal was essen. Auch der beschäftigste Familienvater muss mal aufs Klo. Und selbst der überfordertste Student muss mal zum Arzt. Außerdem erwischt niemand den Bus oder Zug immer rechtzeitig.
Es sind eben diese »Zwischenzeiten«, die in den vergangenen 10-15 Jahren konsequent der Digitalisierung zum Opfer gefallen sind. In jeder uns vom Leben zugemuteten Leersekunde erstrahlen unsere Gesichter nun im bläulichen Licht der Displays, weil wir gerade nochmal kurz die Mails checken, eine SMS verschicken, durch die News scrollen wollen… oder uns mit angestrengtem Blick auf die Apps fragen, was wir überhaupt Nachschlagen oder Aufrufen wollten. Denn der Griff zum Smartphone ist längst zum psychomotorischen Reflex geworden.
Der Leitartikel eines Lifestylemagazins informiert mich derweil, dass die großen Technologiekonzerne mit Hochdruck an der Entwicklung wasserdichter Smartphones arbeiten. Damit wir auch unter der Dusche und in der Badewanne nicht mit uns alleine bleiben müssen…
Verheissungsvolle Resonanz
Tritt aber nicht gerade in solchen ungenutzten (aber nicht unnützen) Momenten zum Vorschein, was dem menschlichen Leben insgesamt Qualität und Sinn verleiht? Zumindest insofern es sich um Zeiträume handelt, in denen wir nicht versuchen, effektiv oder produktiv oder erfolgreich zu sein, sondern die Gelegenheit erhalten, durchzuatmen und »herunterzufahren« – im Therapeuten-Jargon gesprochen »bei uns selbst anzukommen«.
Dann nämlich geben uns die Verschnaufpausen und Leerzeiten des Alltags Anlass, uns und die Menschen und Dinge um uns herum wahrzunehmen und zu ihnen in ein bewusstes Verhältnis zu treten. Der Soziologe Hartmut Rosa spricht hier von »Resonanzräumen« bzw. vom Eintreten in »resonante Weltbeziehungen«.
Das gute, erfüllte, sinnvolle Leben zeichnet sich für ihn gerade dadurch aus, dass wir uns selbst und unsere »Umwelt« nicht verobjektivieren und zu beherrschen versuchen, sondern dass zwischen uns und unserem Körper, unseren Mitmenschen, unserer Arbeit sowie der Natur etwas »in Schwingung« kommt.
Das hört sich nun esoterischer an als es gemeint ist: Es geht Rosa vor allem darum, aus dem unseligen Verwertungszusammenhang auszusteigen, der unsere moderne Gegenwart bestimmt und diese Welt letztlich zum Verstummen bringt. Wenn unser Leben keinen Raum mehr lässt für die genannten Wechselspiele, dann versiegt auch die Quelle der Inspiration, der Lebendigkeit und Erfüllung.
Es versteht sich von selbst, dass Rosa damit nicht nur auf Wartezeiten in der Bushaltestelle oder Pausen zum Essen und Austreten anspricht, sondern vielmehr eine Haltung zum Leben überhaupt meint. Sie wird aber eben in jenen rar gewordenen Momenten besonders greifbar, die wir nicht »verwerten« können, in denen wir nicht eingespannt sind in Sachzwänge und Ambitionen, sondern in denen wir unsere Gegenwart wahrnehmen und wertschätzen können.
Vertagte Sorgen
An zentraler Stelle in der Bergpredigt findet sich eine Ermutigung, die mitten in diese Befindlichkeit hineinspricht und auch den Zusammenhang zur Unvorhersehbarkeit und Risikohaftigkeit des Lebens herstellt. Jesus von Nazareth schließt mit diesen Worten jene bildgewaltige Passage ab, welche seinen Nachfolger*innen die Angst vor der Zukunft austreiben möchte:
»Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag! Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt.« (Matthäus 6,34)
Ausgerechnet aus einem überraschend nüchternen Realismus gewinnt Jesus hier einen Grund gegen die Sorge um Morgen: Ja, jeder kommende Tag wird seine Lasten, seine eigenen Herausforderungen und Hürden mit sich bringen. Welche das sein werden, das war schon zu biblischen Zeiten schwer abzusehen, und noch weniger heute. Wir leben in einer hoch volatilen Risikogesellschaft und liegen mit all den aufwändigen Analysen und Prognosen viel zu oft daneben, um unsere gegenwärtige Gemütslage davon abhängig zu machen.
Selbst wenn auch der heutige Tag nicht sorgenfrei ist – was Jesus durchaus zugesteht –, so tut es der Gegenwart doch ausgesprochen gut, wenn sie nicht mit den Lasten der Zukunft auch noch beladen wird. Der heutige Tag hat seine eigene Last, aber er hat eben auch seinen eigenen Zauber.
Er bietet (aufgezwungene oder gesuchte) Momente des Innehaltens, Gelegenheiten zum Genuss (selbst wenn es nur eine Tasse Kaffee ist), Einbrüche von Sonnenstrahlen, inspirierende Begegnungen mit anderen Menschen und vieles mehr.
Göttliches Wohlwollen
Die Freiheit, seine Sorgen um drohende Gefahren und Entbehrungen loszulassen, erwächst gemäß der Bergpredigt dem Vertrauen in die unverbrüchliche Gegenwart Gottes. Es ist nicht so sehr eine Übung im Ausblenden negativer Gedanken und im Unterdrücken niederschlagender Gefühle, welche Jesus hier propagiert.
Das Sorglosigkeitsprogramm Jesu dreht sich vielmehr darum, die Zukunft wie die Gegenwart vom Wohlwollen Gottes umfangen zu sehen.
Genauer noch scheint es darum zu gehen, die Zuwendung Gottes in diesem aktuellen Moment anzuerkennen – und daraus die Zuversicht zu schöpfen, dass auch die Zukunft unter dieser Zuwendung stehen wird. Dass Jesus die Vögel am Himmel und die Lilien auf dem Feld beizieht, um an der Unbeschwertheit dieser Geschöpfe Maß zu nehmen (»Seht euch die Vögel an! Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte, und euer Vater im Himmel ernährt sie doch…«; Matthäus 6,26), kann dann auch auf eine Befreiung zur dankbaren Wahrnehmung der Welt hin gedeutet werden:
Erst wenn wir lernen, den Moment wahrzunehmen und wertzuschätzen, werden wir an den Vögeln und Blumen des Lebens – und vielleicht auch an Geigenspielern in der U-Bahn – nicht achtlos vorbeigehen.
Illustration: Rodja Galli