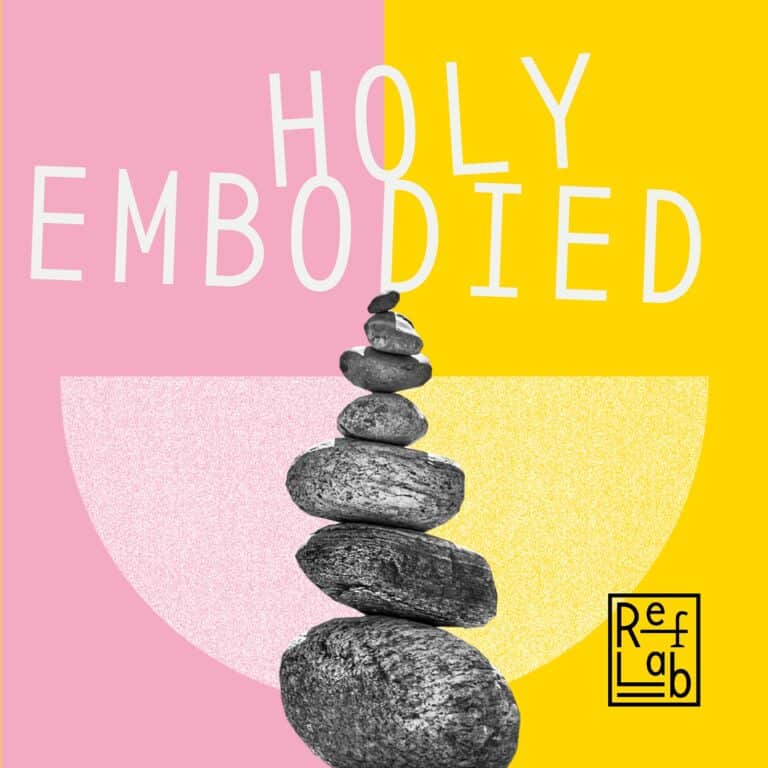1. Zeit
Im Alltag scheint die Zeit eine feste Grösse zu sein, etwas, was man ernst nehmen muss, dem man sich unterwirft.
In diesen Tagen habe ich wieder einmal neu erlebt, wie surreal Zeit ist. Die Tage waren endlos und gingen dennoch irgendwie sehr schnell vorüber.
Ich erinnere mich daran, wie ich letzten Donnerstag erstaunt feststellte, dass die Woche schon beinah durch ist und ich praktisch rein gar nichts gemacht hatte. Und mich trotzdem sehr gut unterhalten fühlte. Wenn man dem so sagen will. Wenn es wenig im Aussen, in der Welt draussen zu tun gibt, fällt dieses ständige Diktat der Zeit weg – es spielt keine Rolle, wann ich was tue. Natürlich gab es auch in diesen zehn Tagen Dinge, die zu tun waren. Yogastunden via Zoom zum Beispiel, Videos für Holy Embodied, eine neue Podcastfolge. Doch die Reihenfolge, in der die Dinge erledigt wurden, war sehr frei. Und auch sehr zufällig. Doch mir fiel vor allem die grosse Freiheit auf, wenn ich einfach auf den Rhythmus des Moments hören kann. Was ist jetzt grad dran? Filmen, Yoga vorbereiten, Audio schneiden?
2. Druck
Wenn ich so auf den Moment hören kann, merke ich auch den inneren Druck sehr deutlich; ein Druck, produktiv zu sein, endlich zu arbeiten. Dabei zählen Dinge wie Aufräumen, mit den Katzen spielen, ein Jäggli fertig lismen natürlich nicht, wo kämen wir denn hin. Sagen zumindest die verinnerlichten Stimmen. Die pochen darauf, dass Arbeit nur so und so einen Wert hat, nur so und so aussehen kann. Gespeist sind sie aus unserer Kultur, aus meinen Vorbildern als Kind und den Erfahrungen als junge Frau in der Arbeitswelt. Ganz deutlich war das am Montag vor einer Woche, dem zweiten Tag der Quarantäne, um sieben Uhr morgens.
Ich wachte auf und hörte, wie rund um mich die Welt sich bereit machte, mit der Arbeit zu beginnen. Die Bauarbeiter mit ihren Maschinen, die Nachbarn mit ihren schnellen Schritten, das Wuseln der Stadt, das zu mir hoch dringt. Eine Geschäftigkeit, die zu schwingen beginnt. Und ich, ich war noch nicht bereit, aufzustehen.
Es war viel wahrer, einen Moment mit meinen Büsis im Bett zu meditieren. Doch der Druck, jetzt doch bitte dann mal aufzustehen und damit zu beginnen, die To Do-Liste abzuarbeiten, der baute sich praktisch mit jeder Minute weiter auf. Krass. Wann genau haben wir verlernt, auf sowas wie einen natürlichen Rhythmus zu vertrauen und einfach durchzustieren, ghauenodergschtoche? Wow.
3. Vertrauen
Wie gesagt, diesem inhärenten Rhythmus zu vertrauen, fühlt sich an wie tausend Tode sterben. Ohni Scheiss. Wenn nicht ich bestimme, wann was gemacht wird, wie kann ich dann wissen, dass es gemacht wird? Das ist genau der Punkt:
Der interne Kontrollfreak dreht damit völlig durch und ist überzeugt, wenn nicht er schaut, dann tue ich nie mehr irgendetwas.
Was aber nicht weiter schlimm ist und absolut nicht wahr. Die Quarantäne hat mir den perfekten Boden gegeben, diesen Kontrollfreak einfach töibelen zu lassen. (Aso eigentlich war es das Retreat vor der Quarantäne, in dem ich mich tagelang einfach in die Stille verfliessen lassen durfte und so wieder neu entdeckte: Ahja stimmt, ich als Person kann die Fäden nicht zusammenhalten. Hab gar nicht so viel zu sagen, wie ich amel meine. Wie entspannend und befreiend.)
Und weiter darauf zu vertrauen, dass der Moment / das Leben selbst / die Quelle / die Stille sich kümmert. Nicht dann, wenn ich finde, es wäre jetzt dann aber schon mal Zeit (glaub mir, am Freitag hatte ich grosse Zweifel daran, dass überhaupt noch etwas geschehen wird…). Es ist ein Mysterium. Aber ich kann darauf vertrauen, kann den Töibeli ignorieren und erfahre jedes Mal wieder von Neuem und sehr zuverlässig: Shit gets done. Am Samstag und Sonntag passierte Arbeit einfach. Schon fast magisch. Und so viel besser, als ich es mir hätte vorstellen können. (Vertrauen kann ich am einfachsten Üben, wenn ich mich auf den Boden lege. Super simpel.)
4. Allein sein
Wer uns ab und zu hört, weiss, dass die Welt für mich ungetrennt ist. Alles was ist, ist eins. Und ich mein das nicht als abstrakte Idee oder Konzept oder sowas, sondern als direkt erlebtes Gefühl im Körper. Wenn ich also schreibe «allein sein», dann heisst das eigentlich «mit allem was ist, sein». So dass ich auf dem Sofa sitze und mit dem Regen draussen, mit den Bäumen vor dem Haus, ja sogar mit dem See unten in der Stadt zusammen sein kann wie mit Freunden. Das mag befremdlich klingen, ist aber ganz simpel. Das was aus deinen Augen schaut, das was die Töne um dich herum hört, ist dasselbe in jedem andern Menschen, Lebewesen, Ding. Die Aufmerksamkeit oder das Bewusstsein selbst. Das letztlich ungetrennt ist von der Stille, der Quelle. Regelmässige Meditation hilft dabei, das selber direkt zu entdecken.
Und natürlich lohnt es sich, sich zunächst mit sich selbst anzufreunden.
Sich selbst als grossartiger Freund zu entdecken. Wie das geht? Zum Beispiel über ein sich Üben in Selbstliebe oder Selbstsorge. All das erlaubt auch, sich selber richtig gut kennenzulernen und zu merken, wie dieser Körper, dieser Avatar tickt. In welchem Rhythmus sozusagen.
5. Freude
Ja, auch das war ein grosser Teil meiner Quarantäne. Die Freude daran, einfach zu sein. Mit dem Moment. Mit den Büsis. Mit mir. Mit allem. Jeden Tag Yoga zu üben, in welcher Form auch immer. Jeden Tag lange in der Stille zu sitzen. Dann aber auch die Freude, wieder rausgehen zu dürfen. In den Wald, die farbigen Blätter zu sehen, die Luft zu riechen, die Menschen zu hören, selber einzukaufen. So viel Leben! Die Freude, wieder an einem anderen Ort arbeiten zu gehen, wieder direkt mit Leuten zusammen zu sein. So viel Freude!
Klar, es ist nicht immer nur einfach mit all diesen Unsicherheiten umzugehen. Doch was uns dieser Virus sehr deutlich vor Augen führt, ist immer wahr:
Wir haben letztlich keine Kontrolle. Bloss weil etwas war, wie es war, heisst das nicht, dass es so bleibt. Es heisst auch nicht, dass wir ein Recht darauf haben, dass es so bleibt.
Echli weniger Hybris und mehr Demut, das täte uns gut in dieser egomanischen Kultur. Was nicht heisst, dass wir willenlose, schwebende und dümmlich lächelnde Dinge werden, die immer «in der Ruhe bleiben». Doch das ist ein anderes Thema. Für jetzt ist es genug zu sagen: Ja, zehn Tage allein dihei zu sein mag zunächst Angst machen. Doch wenn du dich wüki darauf einlässt und die Zeit nicht künstlich mit Zeug füllst, kann das eine der erfüllendsten Erfahrungen ever sein.
Stay home. Image created by Vanessa Santos. Submitted for United Nations Global Call Out To Creatives – help stop the spread of COVID-19.