Ein Mann hat in Hanau (D) aus vermutlich rassistischen Motiven neun Menschen erschossen. Die Anteilnahme und Debatte über den mutmasslichen Terrorakt in den sozialen Netzwerken ist gross, und speziell ist, dass dabei intensiv über einen Begriff diskutiert wird: Fremdenfeindlichkeit.
Wer „Fremdenfeindlichkeit“ sagt, steht auf der Seite des Täters. #hanau
— Hannes Leitle*in (@hannesleitlein) February 20, 2020
Wer das Motiv als „Fremdenfeindlichkeit“ bezeichne und die Menschen, welche der Attentäter von Hanau erschossen hat, als „fremd“, übernehme die Definition des Täters, meint der ZEIT-Journalist Hannes Leitlein mit seinem Tweet. Denn wer oder was „fremd“ ist, ist immer eine Frage der Perspektive.
Wer entscheidet, wer „fremd“ ist?
Medien, die den Begriff „Fremdenfeindlichkeit“ verwenden, würden die rassistische Problematik indirekt weiter befördern, wird deswegen berechtigterweise kritisiert.
Der DPA-Journalist Froben Homburger trägt mit einem Twitter-Thread (einem kurzen Text in Form von fortlaufen Tweets) zur Klärung bei. Intern habe sich die DPA-Redaktion auf das Wording „rassistisch“ oder „rassistisch motiviert“ geeinigt. Wenn ein*e Politiker*in jedoch von „Fremdenfeindlichkeit“ spreche, könne man das Zitat nicht einfach abändern:
Richtig ist aber auch, dass sich vermeintlich fremdenfeindliche Taten in Wirklichkeit meist gegen Menschen richten, die der Täter allein aus einer rassistischen Perspektive heraus als „fremd“ bestimmt hat. (3/5)
— Froben Homburger (@fhomburger) February 20, 2020
„Frömdele“: für Erwachsene unnötig
Wahrscheinlich bin ich nicht die einzige, die sich bis anhin über „Fremdenfeindlichkeit“ als Begriff nicht gross Gedanken gemacht hat. Aber Sprache prägt, wie wir denken, wie wir die Realität wahrnehmen. Sprache prägt, wie wir anderen Menschen begegnen. Und deswegen lohnt es sich, darüber nachzudenken.
Als kleines Kind habe ich „gfrömdelet“. Unbekannten Menschen in die Augen zu blicken oder die Hand zu geben, war für mich furchtbar unangenehm. Nicht nur Kinder kennen das Gefühl, das mit einem so harmlosen Mundart-Wort beschrieben wird. Für Erwachsene ist „Frömdele“ problematisch. „Das Fremde macht Angst und darum steht es gerne mal unter Generalverdacht. Ob die Angst begründet ist, wird oft gar nicht hinterfragt“, schrieb Pfarrer Tobias Zehnder kürzlich in einem Artikel über die Angst, und wie er selber manchmal mit den Ängsten anderer Menschen konfrontiert ist.
Jeder, der schon mal alleine gereist ist, weiss: Erstens fühlt es sich richtig unangenehm an, wenn man selber mal fremd unter anderen Menschen ist. Und zweitens: Es braucht nur wenige Minuten, dann werden aus Fremden Weggefährten.
Und so sollte uns doch eigentlich gelten: Wir wollen keine Fremden mehr bei uns. Sondern höchstens Unbekannte. Menschen, die wir noch nicht kennen, sind potenzielle Weggefährtinnen, Bekannte, Freunde.
Liebe den Fremden wie dich selbst!
Fremdheit schafft Grenzen, schränkt die Empathie ein. Wenn andere uns Fremde sind, gilt das im Umkehrschluss auch für uns: Dann sind wir auch ihnen Fremde.
Die Literaturwissenschaftlerin Elaine Scarry untersuchte die Hintergründe rassistisch motivierter Anschläge. Fremdheit führe zu Gewalt, so ihre These. Scarry diskutiert im Aufsatz „The Difficulty of Imagining Other Persons“ zwei Ansätze, damit es in einer Gesellschaft mehr Raum für Empathie gibt: Einerseits könne ein Staat per Verfassung Bedingungen schaffen, unter denen es möglichst wenig „Fremde“ gibt. Die zweite Möglichkeit wäre, dass Menschen aus eigener Initiative aufeinander zugehen.
Scarry kommt zum Schluss, dass es beides braucht: Verfassungsmässige Grundlagen schaffen den notwendigen Rahmen, damit Empathie zwischen Unbekannten Platz hat. Jede Art von Ungleichbehandlung, so die Autorin, bleibe eine Ungleichbehandlung, die Grenzen zwischen Menschen aufrecht erhält. Und seien die Rechte der Zugewanderten noch so „grosszügig“ von Seiten der Mehrheit. Ihre provokante These ist, dass ein Staat Delikten vorbeugt, indem Immigrant*innen möglichst rasch die gleichen Rechte erhalten wie Einheimische.
Man kann das als Utopie abtun, aber wir finden den Gedanken bereits im jüdischen Gesetz im Alten Testament: „Wie ein Einheimischer soll euch der Fremde gelten, der bei euch lebt. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid selbst Fremde gewesen in Ägypten.“ (Lev 19,34)
Es braucht nur wenige Minuten, dann ist jemand kein Fremder mehr. Und wir ihm auch nicht.
Elaine Scarry: „The Difficulty of Imagining Other Persons“, in: „The Handbook of Interethnic Coexistence“ (hg. Eugene Weiner), New York 1998
Bild: Ryoji Iwati, Unsplash.

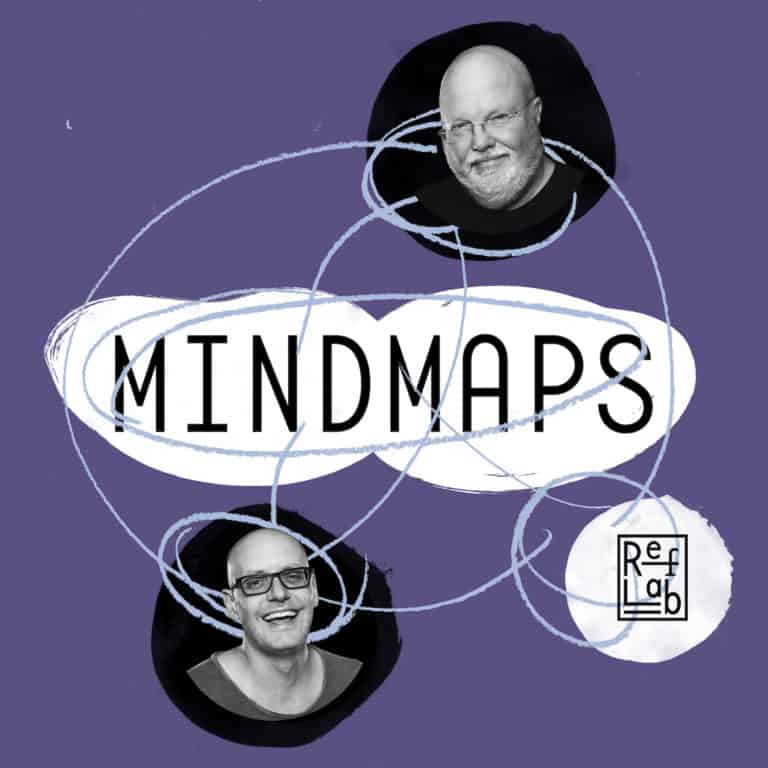



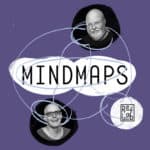


2 Kommentare zu „Wir wollen keine Fremden mehr!“
Wenn das ein Diskussionsforum sein soll, dann ist es wirklich nicht besonders erfolgreich. So denn mein Beitrag. Fremdheit von Menschen oder auch Sachen, Sitten und gesellschaftlichen Konventionen hat nicht nur einen qualitativen sondern auch einen quantitativen Aspekt. Wenn man Fremdheit und Befremdung als Unverständnis interpretiert, dann kann es Momente geben, wo es einfach „genug“ ist. Aktuell leben wir in unseren Breiten in einem extrem vielseitigen gesellschaftlichen Umbruch, der politische, technische und ethische Gebiete umfasst. Nach meiner Meinung betrachten viele diesen Umbruch als etwas „Externes“, das über sie hereinbricht und dem sie ausgeliefert sind. Sie haben den Umbruch nicht gerufen, noch haben sie aktiv Anteil daran. Sie müssen parieren, ohne als Gegenleistung zuverlässige Zukunftsversprechen erwarten zu dürfen. Man sollte sich gut überlegen, welche Predigten man gegenüber solchen Menschen vom Stapel lässt.
Lieber Manuel, jedes Diskussionsforum muss sich erst etablieren – und das RefLab gibt es gerade mal seit 5 Wochen… In dem Sinne: Danke, dass du mitdiskutierst!
Ich verstehe, was du meinst. Jedoch glaube ich, dass man dem Fremdheitsgefühl eben nicht ausgeliefert ist, sondern aktiv etwas dazu tun kann, dass das, was man als fremd wahrnimmt, vertraut wird. Es geht dabei nicht um politisches Handeln, und auch nicht nur um den Umgang mit Immigranten oder Andersgläubigen, sondern um den Alltag ganz allgemein. Fremdheit schafft Distanz und Angst.