Ein neues Scheingefecht zieht auf: Wirtschaft gegen Werte, Geldverdienen gegen Menschenleben retten, Wirtschaftsbetrieb gegen Quarantänebetrieb, Epidemiolog*innen gegen Ökonom*innen. Soll der Wirtschaftsbetrieb schrittweise wieder aufgenommen, die Ladenschliessungen gelockert werden? Oder sollen die Bewegungsradien möglichst knapp gehalten, die Ausbreitung des Virus eingedämmt werden? Die Meinung scheint schnell gemacht: Nichts ist wertvoller, als die Gesundheit.
Aber stimmt das?
Natürlich sind wir alle am liebsten gesund. Wer krank ist, weiss was fehlt, wenn man nicht gesund ist. Gesundheit ist unsere Möglichkeit am Leben teilzuhaben, sich auszudrücken, sich zu beteiligen. Ohne Gesundheit ist alles nichts wert: Das beste Essen, die schönste Wohnung und das Traumauto. Also klar: Gesundheit ist wichtiger als Geld.
Dahinter steckt ein bestimmter Begriff von «Geld». Und zwar einer, der zu wenig erklärt. Und diese kurzschlüssige Erklärung hat eine christliche Wurzel: «Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.» soll Jesus gesagt haben. Das ursprünglich aramäische Wort ‘Mammon’ bedeutet eigentlich schlicht «Vermögen», «Reichtum» oder «Besitz». Es avancierte aber schon bald zu einer personifizierten Gegengottheit. Dass Luther ‘Mammon’ nicht übersetzt, hat diese Interpretation sicherlich befördert. In der Folge konnten Menschen also entweder Gott oder dem Mammon – einer geldgierigen Gottheit – vertrauen. Und was der Mammon heute ist, scheint klar: Das Geld.
Geld ist mehr!
Aber Geld ist mehr. Geld ist nicht einfach die Summe all dessen, was man besitzen kann. Geld ist ein Kommunikationsmittel, das Beziehungen ausdrücken und Arbeitsergebnisse speichern kann. Und Geld ist ein Möglichkeitsspielraum. Wer Geld verdient, kann es für verschiedene «Dinge» ausgeben. Geld übersetzt meinen gesellschaftlichen Beitrag in meine gesellschaftlichen Ansprüche. Wer zum Beispiel Brötchen verkauft, kann aus dem Gelderlös Urlaub machen, ein Ladenlokal mieten, ein Bett kaufen, ein Auto leasen, seine Zukunft in Form von Kranken-, Unfall-, Hausrats- und Sozialversicherungen absichern. Brötchen backen wird durch Geld übersetzbar in «Urlaub», «Raummiete», «Bett», «Mobilität» und «Sicherheit».
Geld ist also das Medium, das uns hilft, unsere Leistung in das umzuwandeln, was wir brauchen. Und Geld ist das Medium, mit dem wir alle zusammen auch die Bedürfnisse derjenigen befriedigen können, die nicht oder unterdurchschnittlich viel leisten können. Durch Geld schaffen wir einen Ausgleich an wirtschaftlichen Möglichkeiten, zwischen denen, die viel verdienen und denen, die fast nichts verdienen. Das ‘Soziale’ am Sozialstaat, die Werte wie «Chancengleichheit», «sozialer Friede», «Gerechtigkeit» und das Anliegen, die wirtschaftliche und soziale Situation – insbesondere benachteiligter Gruppen – auf einem bestimmten Level zu halten oder zu verbessern, werden durch «Geld» ausgedrückt.
Aber nicht alles…
Geld ist also die handlungsfähige, verwandelbare und verteilbare Form unserer Leistungen. Allerdings – und das spüren wir in diesen Tagen, in denen Grosseltern nicht mehr die Kinderbetreuung übernehmen können, deutlich – vergelten wir längst nicht alles, was «wertvoll» ist, mit Geld. Für unser Zusammenleben notwendige Bereiche werden von der «Geld-Kommunikation» ausgenommen. Dazu gehören sowohl ehrenamtliche oder freiwillige Tätigkeiten in Vereinen und Hilfeleistungen für Nachbarn und Verwandte, wie auch Haus- und Betreuungsarbeiten. Dieser Bereich übernimmt gegenwärtig viele Funktionen und Dienstleistungen, die neuen Bedürfnissen entsprechen – Einkauf für Senior*innen, Homeschooling, etc. – oder kommt bestehenden Nachfragen ausserhalb der «Geldkommunikation» nach: Haareschneiden, Kinderbetreuung, Fahrdienste, etc.
Diese Entwicklung verdeutlicht nur, was wir schon lange wissen: Die unbezahlte Arbeit – oft die Arbeit von Frauen, von Alleinlebenden und von älteren Menschen ist nicht nur systemrelevant, sondern ungeheuer wertvoll. Und umfangreich:
Schweizer*innen arbeiten pro Jahr im Durchschnitt 1320 Stunden. Das ergibt ein Total von 17,1 Mia Arbeitsstunden. Mehr als die Hälfte davon (9,2 Mia) sind unbezahlt.
Ob wir nach der Pandemie in das selbe System zurückkehren werden, das zwischen Erwerbsarbeit und unbezahlter Arbeit so selbstverständlich unterscheidet? Wahrscheinlich schon. Aber vielleicht – hoffen darf man das – mit einem anderen Bewusstsein dafür, dass die unbezahlte Arbeit nicht nur wertschöpfend sondern systemrelevant ist. Ob sich das auf die Umverteilung auswirken wird? Es müsste eigentlich.
Geld und Gerechtigkeit
Das Geld, das jetzt nicht erwirtschaftet, in Löhnen ausbezahlt und durch Konsum, Steuern und Abgaben verteilt wird, fehlt. Es wird weniger Spielraum geben, Geld umzuverteilen. Dadurch werden die Chancen an der Gesellschaft teil zu haben für viele Menschen geringer. «Wirtschaft, Erwerbsarbeit und Geld» sind kein Gegenüber zu «Leben». Sie sind das, was Leben ermöglicht, gestaltbar und frei macht. Wie wir Geld umverteilen, wofür wir es ausgeben und was wir erschaffen, um Geld zu verdienen, entscheidet über den immateriellen Wert. Aber niemals steht Geld an und für sich Werten wie Freiheit, Gerechtigkeit, Lebensfreude oder unserem Potential diese Werte zu befördern als Gegner gegenüber!
Geld und Gesundheit
Ohne Gesundheit ist alles nichts. Ja. Aber es stimmt auch, dass es keine Gesundheit, keine Sicherheit und für uns Menschen kein Überleben ohne Geld gibt. Die Gegner*innen einer baldigen, wenn auch schrittweisen Wiederaufnahme des Wirtschaftsbetriebs stellen gerne die rhetorische Frage, wieviel ein Menschenleben, das durch die Pandemie-Massnahmen gerettet werden kann, «wert» ist. Das klingt so plausibel. Aber es ist kurzsichtig. Die richtige Frage ist nämlich:
Wie viele Menschen der jetzt unter 45-Jährigen dürfen in 20 Jahren von Altersarmut, wie viele aus sozial prekären Verhältnissen mit noch grösserer Chancenungleichheit, wie viele von einer Zweiklassenmedizin, eigeschränkten Mobilitätsmöglichkeiten und den Folgen fehlender nachhaltiger Energiegewinnung betroffen sein?
Geld ist nicht alles. Aber Gesundheit, im Sinne einer Gesundheit einer ganzen Bevölkerung, gibt es auch nicht ohne Wirtschaft und ohne Geld. Und was passiert mit der politischen Stimmung, wenn die Wirtschaft in eine Rezession stürzt? Rezessionen bedeuten nicht nur fallende Börsenkurse, sondern auch Entlassungen, Kurzarbeitszeit, fehlende Investitionen, mangelnde Innovation.
Und nicht selten verbinden sich pessimistische Wirtschaftsprognosen mit dem Erstarken nationalistischer Gebaren. Man denke nur an die Weltwirtschaftskrise (1929), die Ölkrise (1979) – und ihre Folgen für die Entwicklungs- und Schwellenländer – oder die Finanzkrise ab 2007 – und das, was sie mit der EU angerichtet hat. Gegenüber der Finanzkrise gibt es einen grossen Unterschied: Diese hat die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen betroffen. Die Corona-Krise ist gleichzeitig ein Angebotsschock. Das heisst, der Staat kann nicht einfach eine Nachfrage simulieren, um die Wirtschaft anzukurbeln. Es steht nicht Geld gegen Leben. Es geht um die Rettung und Bewahrung unserer Volkswirtschaft, die Leben – so wie wir es kennen – ermöglicht.
Geld und Leben
Es ist sicher nicht der Moment, sich jetzt entweder auf die Seite der Epidemiolog*innen oder auf die Seite der Ökonom*innen zu schlagen. Und so einfach wäre das gar nicht. Die sind sich untereinander auch nicht einig. Was wir jetzt brauchen, ist die Lernbereitschaft beider: Die Ökonom*innen sollen die Prognosen der Epidemiolog*innen kennen. Sie sollen wissen, womit wir zu rechnen haben, wenn sich die Menschen wieder mehr bewegen, sich dabei auch näher kommen. Und die Epidemiolog*innen finden in den umfassenderen sozial- und wirtschaftstheoretischen Modellen Erweiterungen für das, was wir unter Vitalität, Wachstum und Gesundheit verstehen.
Und dann wäre es an der Zeit, eine politische Öffentlichkeit in die Prognosen und Modelle einzuweihen, damit sie informiert und im Rahmen demokratischer Verfahren über ihre Freiheit, Gesundheit und Zukunft mitentscheiden kann.
Und es wäre schön, wenn wir, die wir diese Öffentlichkeit sind, dann auch an die denken, die nicht entscheiden konnten, ob sie zuhause arbeiten, oder sich in Supermärkten, Apotheken, Wartezimmern und Spitälern, Kitas oder dem öffentlichen Verkehr der Gefahr aussetzen. Und wenn wir eine Kultur – und eine Volkswirtschaft! – der Dankbarkeit denen gegenüber entwickeln, die freiwillig, unbezahlt systemrelevant sind.
P.S. Wir könnten damit anfangen, Blumenerde und Setzlinge in den Supermärkten nicht mehr abzudecken. Und kleine Blumen-Läden für bis zu 5 Besucher*innen zu öffnen. Es passt vielleicht nicht zu Corona. Aber zum Frühling. Und es ist gut fürs Gemüt und die Wirtschaft und vielleicht ja auch für die Gesundheit 😉
Photo by Miguel Á. Padriñán from Pexels
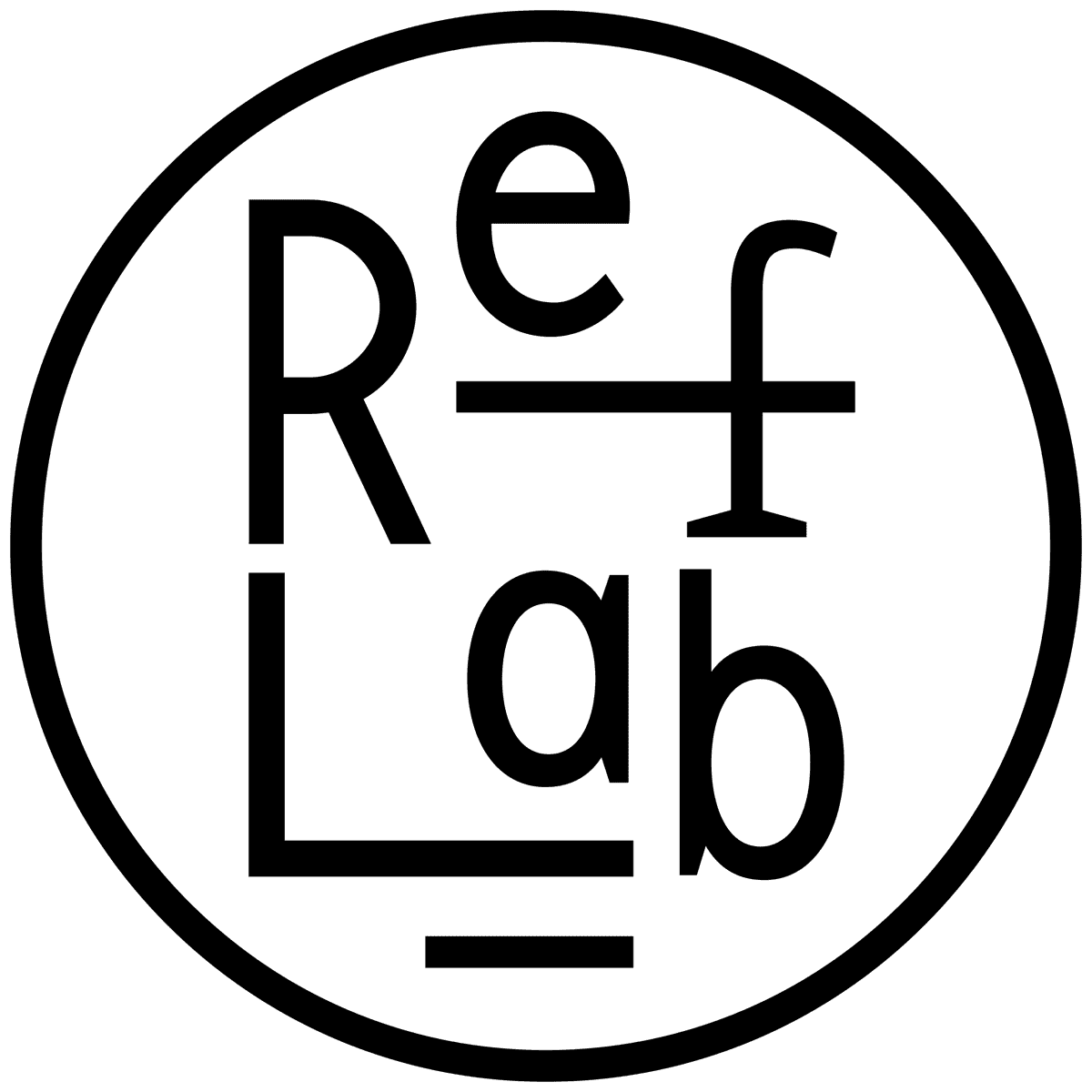







1 Gedanke zu „Gott oder Geld?!“
Vielen Dank für diesen interessanten, ermutigenden Artikel!!!
Ja, die Entscheide, wie es jetzt weitergehen soll, müssten unbedingt breiter, demokratischer abgestützt werden. Es wird so einseitig argumentiert. Warum wird nur über die Zahl der Gestorbenen gesprochen (im schlimmsten Fall 90’000, was 1% Prozent der Bevölkerung entspricht) und nicht beispielsweise über die mehr als 900’000 Schulkinder, von denen die wenigen glücklichen zu Hause gefördert werden und die andern halt Pech gehabt haben? Warum sprechen wir nicht über die Kinderpsychiatrie, die im Moment sehr viele Notfälle = Suizidgefährdete haben? Warum sprechen wir nicht über die Unterstützung der Trauernden, sondern lassen die Sterbenden und ihre Angehörigen alleine? Warum sprechen wir nicht über die momentane Lebensnichtqualität der alten, isolierten Menschen? Können wir in der Krise, die auf den Coronakrise folgt, den alten Menschen noch ein angemessenes Altersgeld finanzieren?
Es gehen mir noch viele Fragen durch den Kopf. Ich könnte diese Situation besser ertragen, wenn nach Abwägen aller Aspekte – und nicht nur der Totenzahlen – sich eine Mehrheit für eine Weg entscheiden würde.
Deshalb meine Frage: Wie könnte man (auf die Politiker) Einfluss nehmen?