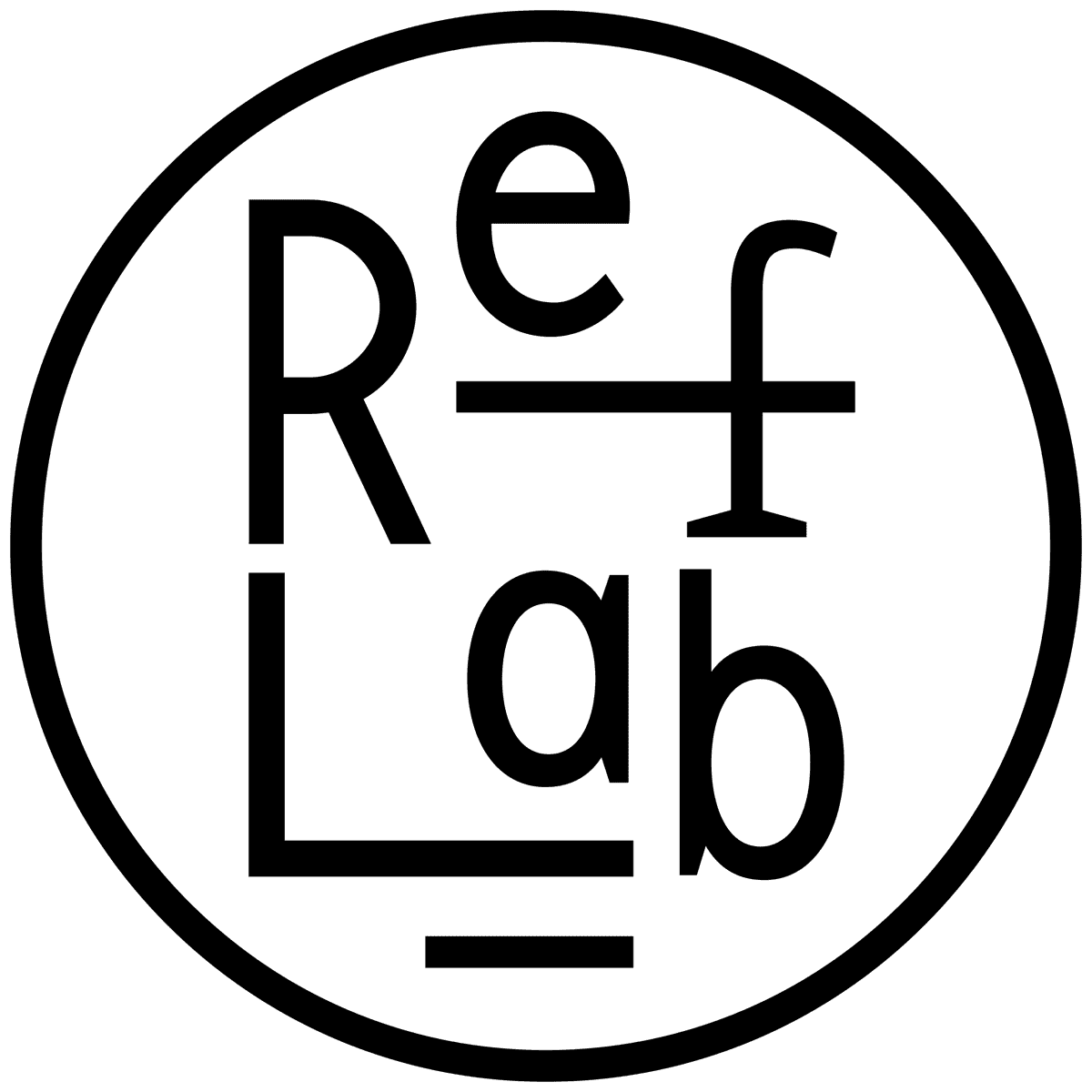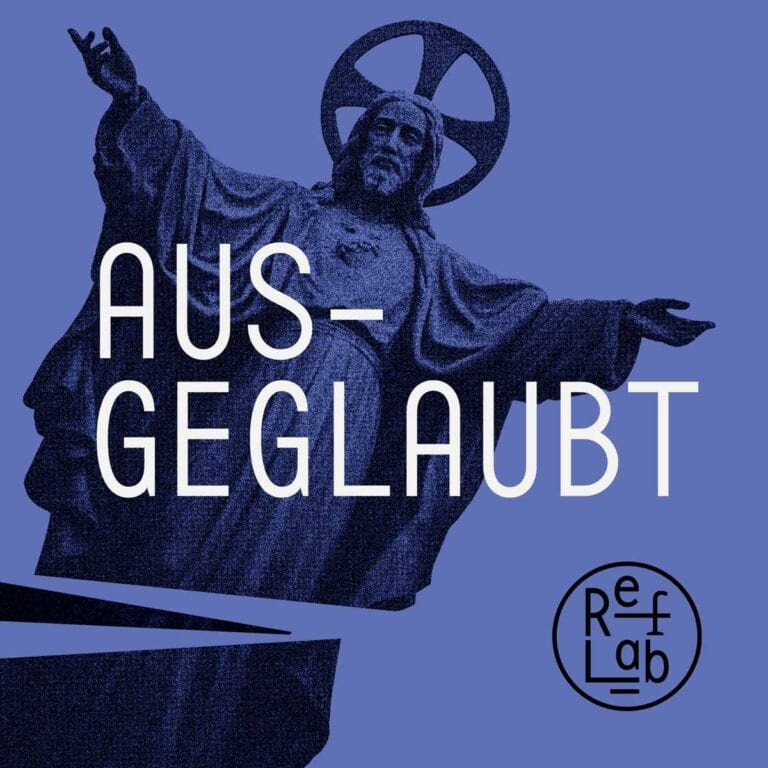Ein Beitrag von Johanna Di Blasi, Janna Horstmann und Evelyne Baumberger.
Evelyne: «Der Wind hat gedreht», hast du, Johanna, gesagt, als wir uns über den Weltfrauentag unterhalten haben. Du hast ein Gefühl in Worte gefasst, das mich auch ergriffen hat. Mit #MeToo und der Popularisierung des Feminismus unter jungen Frauen schien es die letzten zehn Jahre so, als kämen patriarchale Ungleichheiten endlich alle ans Licht. Und als seien wir Frauen damit endlich auf dem Weg zu echter Gleichstellung.
Alles eine Illusion?
Als Trump wiedergewählt wurde, schrieb ich einen Artikel unter dem Titel «Auf halbem Weg nach ‹Handmaid’s Tale›?» und spielte damit auf den dystopischen Roman von Margaret Atwood an. Tatsächlich schafft die Trump-Regierung «Diversity, Equality, Inclusion»-Programme ab und setzt sich damit aktiv gegen Gleichstellung ein.
Gefühlt scheint es nicht unmöglich, dass Frauen auf der ganzen Welt (dort, wo sie sie haben) die Rechte wieder verlieren, die ihre Mütter und Grossmütter hart erkämpft haben. Gleichzeitig ist dieses Schockgefühl, das mich jetzt beschleicht, wohl die Angst einer privilegierten, gebildeten, weissen Frau, die überhaupt der Illusion von Gleichberechtigung erliegen konnte.
Ist das nun die Landung auf dem harten Boden der Realität?
Wenn es im gleichen Tempo vorwärts, oder präziser: rückwärts geht wie aktuell in den USA, frage ich mich, wo wir in 20, 30, 50 Jahren stehen werden. Kommt es mit den konservativen Bewegungen, die überall stärker werden, von einem kalten Wind zu einer neuen patriarchalen Eiszeit?
«Winter is coming!»
Johanna: Dein Satz mit der Frage nach dem möglichen Einbruch einer Eiszeit hat mich nun ebenfalls an einen Film denken lassen bzw. eine Serie: «Game of Thrones». Wir erleben gerade atemberaubende und hoch gefährliche Spiele um Throne, Verschiebungen im geopolitischen Machtgefüge. Shakespeare-reif! Das Klima ist merklich rauer und kälter.
Und es fällt schon auf: Es sind fast nur Männer auf der Bühne.
Klimaschutz, Schutz von Minderheiten und Benachteiligten (sozial, kulturell, ethnisch, sexuell): Das alles scheint unter dem Trump-Regime in den USA , wo wir gebannt hinsehen, hinten runter zu fallen. Emanzipatorische Formen wie Feminismus werden nicht bloss fallengelassen oder weggewischt, sondern sie werden im konservativen Kulturkampf zum Feind erklärt.
Eine linke, «woke» Aganda, so das Narrativ, habe die wahren Werte (von Familie, Religion etc.) untergraben.
Ich glaube, es ist jetzt der Moment, um noch deutlicher für das Christentum aufzustehen, für das wir brennen. Die emanzipatorischen Ansätze sind aus sozialen Bewegungen hervorgegangen und auch aus Theologien der Befreiung. Woran können wir als Christ:innen anknüpfen, Janna?
Liebe deine Supermarktverkäuferin
Janna: Gute Frage. Ich bin auf jeden Fall weder ein Fan von «Game of Thrones» noch von «Handmaid’s Tale». Zumindest würde ich in keiner dieser Welten leben wollen. Nichts tun ist aber offensichtlich keine Option. Trotzdem frage auch ich mich, wo anknüpfen? Die Schuhe der Befreiungstheolog:innen sind mir etwas zu gross.
Also da, wo wir immer anfangen. Bei uns selbst und den Menschen, die uns umgeben. Bei unserer Nächsten.
Im Zuge der Wahl in Deutschland habe ich mich bereits gefragt, mit wem solidarisieren. Aber was macht es mit einer Gesellschaft, wenn ich als weisse, privilegierte, gebildete Frau – wie Evelyne es so schön formuliert – wenn ich mich nicht mehr frage, mit wem ich mich solidarisiere, sondern gegen wen. Weil ich auf einmal selbst zum Feindbild geworden bin. Wie absurd sich das anfühlt.
Die Welt in Feindbildern zu denken, scheint mir wenig produktiv. Aber ob Empathie schon politikfähig geworden ist, wage ich zu bezweifeln. Sicherlich, es gibt sie, die grossen Gesten, die Kniefälle und Schulterschlüsse, aber ich vermisse aktuell die Politiker, die über ihr Ego hinausdenken können.
Liebe deine Nächste, wie dich selbst.
Ich stelle mir vor, wie sie alle ein Banner mit diesem Vers als Hintergrund auf ihren Smartphones haben, das sie daran erinnert, wenn sie die nächsten frauenfeindlichen Gesetze verabschieden. Liebe deine Schwester, wie dich selbst. Liebe deine Haushaltshilfe, wie dich selbst. Liebe deine Supermarktverkäuferin, wie dich selbst. Liebe deine Tochter, wie dich selbst, Donald Trump!
Eine solidarische Bewegung
Evelyne: An Empathie für Frauen so zu appellieren, dass es sich ja um die eigene Tochter/Mutter/Schwester handeln könnte, ist eine Strategie, die mir bekannt vorkommt. Sie greift m. E. allerdings kommunikativ zu kurz: Frauen sollten nicht Rechte haben, weil wir Ehefrau/Tochter/Mutter eines Mannes sind, sondern, weil wir Menschen sind.
Frauenrechte sind Menschenrechte.
Janna, dein Satz zur Solidarität spricht mich an: Wir sollten dem «sich gegen jemanden solidarisieren» widerstehen und uns stattdessen miteinander solidarisieren. Als Frauen untereinander, in einer «Revolution der Verbundenheit», von der die Geschlechterforscherin Franziska Schutzbach schreibt.
Aber eben auch mit all denjenigen, deren Rechte heute ebenfalls bedroht sind – oder ihnen bereits weggenommen wurden: Menschen auf der Flucht, queere Menschen, Menschen mit Beeinträchtigungen, die von rechten Influencern auf Social Media Shitstorms preisgegeben werden. Männer, Frauen und überhaupt Menschen, die nicht in der Dystopie leben wollen, die uns droht.
So versteht sich ja auch ein grosser Teil des heutigen Feminismus: Als sogenannte «intersektionale» Bewegung, also als Bewegung all derjenigen Menschen, die in einer Gesellschaft benachteiligt sind, in der der ideale Mensch ein weisser, reicher, einheimischer sowie körperlich und psychisch gesunder Mann ist.
Verbunden in Schmerz und Sehnsucht
Johanna: Vielleicht steuern wir auf Zeiten zu, wo es nicht mehr reicht, Feministin zu sein. Vielleicht müssen wir tatsächlich wieder Frauenrechtlerinnen werden, nach dem Vorbild der Pionierinnen der Frauenbewegung.
Ich denke allerdings auch, dass es kaum zu leugnen ist, dass manches auf Seiten der Identitätspolitik in den zurückliegenden Jahren ins Extrem getrieben wurde (Stichwort: Cancel Culture). Selbst die von dir, Evelyne, eingangs erwähnte #MeToo-Bewegung ist nicht frei von Ambivalenzen. Anschuldigungen können auch Unschuldige treffen.
Überdies kann auch Mann unprivilegiert sein, sogar weisser Mann.
Dies zu übergehen zeugt nicht nur von Überheblichkeit, sondern kann direkt in «Proud Boys»-Revolten münden, wie das Beispiel USA belegt. Etwas wehrt sich auch ganz grundsätzlich in mir, den Fokus auf Frauen als mal mehr, mal weniger Benachteiligte zu legen (am Weltfrauentag mag das o.k. sein).
Kürzlich wurde ich auf einen berührenden Brief von Rosa Luxemburg gestossen: ihren «Büffel-Brief», verfasst im Gefängnis. Das von Soldaten geschundene Tier hatte Augen wie ein verweintes Kind. Sie notierte: «Oh, mein armer Büffel, mein armer, geliebter Bruder, wir stehen hier beide ohnmächtig und stumm und sind nur eins in Schmerz, in Ohnmacht, in Sehnsucht.»
Durch fortschreitende Klimaüberlastung und neue Kriege werden viele unschuldige Leben aufs Spiel gesetzt.
Janna: Und so stehen wir denn mit den Büffeln und der #metoo-Bewegung, Menschen auf der Flucht, queeren Menschen und allen anderen nicht privilegierten, aussätzigen, abgeschotteten und benachteiligten Menschen jedweden Geschlechts beisammen und solidarisieren uns für die Rechte all jener.
Aber reicht das?
Ich weiss nicht, wo euer Schmerz wohnt, mein Schmerz wohnt im Magen. Dort bleibt dieses Gefühl, dass wir mengenmässig viel mehr sind und viel weniger Macht und Rechte haben. Was auch bleibt, ist die Frage, was ich gegen dieses Gefühl in meinem Magen machen kann.
Foto von Sam McNamara auf Unsplash