Corona hat eine Bewegung verstärkt, die bereits vorher vorhanden war: «Indie-» oder «Nomaden-Christ*innen». Menschen, die sich als Christ*innen identifizieren, aber nicht regelmässig die Angebote einer bestimmten Kirchgemeinde nutzen oder sich dort engagieren. Wie christlicher Glaube auf diese Art gelebt werden kann, dazu der Artikel «’Indie-Christen‘: Nomadinnen zwischen Lagerfeuern».
Viele Menschen können sich damit identifizieren. Doch immer wieder erhalte ich auf dieses Konzept und diesen Glaubensstil, über den ich im RefLab schreibe, auch kritische Reaktionen. Und es stimmt, das «Indie-Christsein» hat auch Nachteile.
1. Mit wem teilt man den Glauben?
Wirklich «Indie», «independent» (unabhängig) ist man nie, da hat der schweizerdeutsche Kirchenklassiker «Werom gaht’s dänn nöd als Solo-Christ» aus den 70ern Recht. Aber wo findet man solche Menschen, wenn nicht in einer Kirche?
In einer kleinen Instagram-Umfrage zu den Nachteilen des Nomadenchristseins war dieser Punkt der meistgenannte. «Ich treffe nicht mehr ‚automatisch‘ die Freunde, die ich früher in der Kirche hatte», schrieb jemand. «Der Austausch mit Gleichgesinnten gestaltet sich schwieriger», «Weniger emotionale Zugehörigkeit», «Manchmal fühlt es sich sehr einsam an», waren weitere Antworten. Jemand bemerkte, dass es weniger ein Korrektiv gäbe und er sich nun aktiver Feedbacks einhole. Und eine weitere Person schrieb, sie vermisse die Vielfalt der Menschen in der Gemeinde und habe manchmal das Gefühl, in einer Bubble von ähnlich denkenden Menschen zu sein.
Gerade Menschen, deren Glaube sich im Umbruch befindet und die eine Gemeinde verlassen, fühlen sich oft alleine.
In einem solchen Prozess stösst man bei vielen Christ*innen auf Unverständnis, erntet manchmal sogar Vorwürfe, dass man «nicht genügend glaubt».
Wenn man ehrlich über die eigenen Fragen spricht, kommt es aber auch vor, dass manche überraschend zugeben, dass sie sich eigentlich die gleichen kritischen oder schwierigen Fragen stellen – aber immer glaubten, damit die einzigen zu sein.
Es ist viel wert, Freund*innen zu haben, mit denen man über den eigenen Glauben sprechen kann, offene Fragen diskutieren, oder mit denen man beten kann. Eine oder zwei Personen können da schon ausreichend sein, um sich gegenseitig zu tragen und miteinander durchs Leben zu navigieren.
Social Media sind heute definitiv eine Hilfe. So findet man unter dem Hashtag #Dekonstruktion ganze Communities von Menschen, die sich von traditionellen Kirchen gelöst haben. Dies kann Offline-Kontakte nicht komplett ersetzen, aber erstens ergibt das eine manchmal das andere, und zweitens findet man einen guten Austausch und Menschen, die ähnlich unterwegs sind.
2. Regelmässige theologische Impulse fehlen
Idealerweise hört man in Gottesdiensten jeweils eine Predigt, welche Bibeltexte exegetisch beleuchten, Impulse aus christlicher Perspektive für den Alltag geben oder einen zu weiteren Gedanken herausfordern. Das fällt weg. Viele der «Nomaden-Christ*innen», die ich kenne, befassen sich jedoch genauso aktiv mit ihrem Glauben als vorher. Sie hören Podcasts, lesen Bücher und Artikel, machen bei Book Clubs mit oder diskutieren auf Social Media.
Um sich mit Glaubensfragen zu beschäftigen, braucht man schon längst nicht mehr zwingend in einen Gottesdienst zu gehen. Wichtig scheint mir, dass man sich grundsätzlich mit anderen darüber austauscht, um nicht in schrägen Philosophien zu landen.
3. Singen
Musik ist ein wichtiger Teil eines Gottesdienstes und derjenige, den ein Podcast nicht ersetzen kann. Gemeinsames Singen geht unter die Haut, berührt emotional und spirituell andere Bereiche als das gesprochene Wort. Auch wenn ich selber beim Worship in einer Freikirche nie von Herzen dabei war, weiss ich, dass diese Art gesungenes Gebet vielen Menschen extrem viel gibt. Das geht nicht alleine, und für viele ist das ein grosser Verlust.
Wenn das «Nomaden-Christsein» auch mit einer Dekonstruktion des Glaubens einher geht, ist es noch komplexer: Sei es, dass die Anwesenheit Gottes nicht gespürt wird und Texte wie «You are here, touching every heart» mehr Wunsch als Gewissheit sind. Oder dass Zeilen wie «Würdig das Lamm, das geopfert ist» nur noch fremd wirken, oder «Nothing but the blood of Jesus» eklig.
Viele Liedzeilen können nicht mehr aus vollem Herzen gesungen werden, weil die Theologie dahinter als problematisch wahrgenommen wird. Oder weil sich die beschriebenen Erfahrungen nicht mit dem eigenen Erleben decken.
4. Bei alternativen Kirchenformen fallen Menschen durch die Maschen
Das ist der Punkt, der mich am meisten beschäftigt: Kirchgemeinden sind generell sehr niederschwellig. Die Gottesdienste und Angebote sind grundsätzlich öffentlich, werden auf der Website und auf Plakaten publiziert und wer möchte, darf dabei sein. In Altersheimen gibt es Besuche von einer Pfarrperson, bei einem Mittagstisch sind alle willkommen.
Es stellt sich die Frage, ob «willkommen» gleichbedeutend ist mit «dazugehörend»: Wenn Randständige, Alte oder Menschen mit einer Behinderung am Kirchenkaffee teilnehmen, heisst das noch lange nicht, dass sie als gleichwertige Mitglieder einer Gemeinde wahrgenommen werden, mitgestalten und mitentscheiden können.
Ganz sicher ist dies aber bei «Fresh Expressions» und anderen alternativen Kirchenformen noch schwieriger. Sei es, weil sie sich an eine spezifische Gruppe von Leuten richten, oder weil die Hürden zur Teilnahme hoch sind. Die «Hiking Church» zum Beispiel, die ich co-leite: Menschen mit einer Gehbehinderung oder sonst gesundheitlichen Problemen sind hier ausgeschlossen. Und auch wer nicht davon erfährt, dass es solche Angebote gibt (etwa, weil sie nur online publiziert werden und jemand keinen Zugang zum Internet hat), verpasst sie.
Klar ist:
«Indie-Christsein» oder alternative Kirchenformen oder Gemeinschaften können die traditionelle Kirche nicht ersetzen.
In der Praktischen Theologie nennt man das «Mixed Economy»: dass Kirchen sowohl aus traditionellen Gemeinden als auch aus kleineren, milieuspezifischen Gemeinschaften bestehen.
5. Das schlechte Gewissen
Immer wieder schleicht sich die Frage ein, ob man nicht eigentlich in eine Kirche gehen und sich in einer Gemeinde engagieren müsste. Manchmal komme ich mir wie eine Verräterin vor, gerade in Zeiten, in denen die Kirchen ohnehin immer mehr Menschen «verliert». Ein Bekannter sagte mir mal, wenn ich mich gegen eine Gemeinde entscheide, würde ich ihr meine Gaben verweigern. Diese Worte haben sich bei mir festgesetzt.
Andererseits wird so auch Energie frei, die man woanders investieren kann. Gerade Freikirchen bauen auf unheimlich viel Freiwilligenarbeit. Auch wenn manche Angebote sich an die Öffentlichkeit richten, bleibt vieles innerhalb der Kirche: Worship-Bands, Kirchenkaffee-Team etc. Wenn jemand sich von einer Gemeinde verabschiedet, fehlt diese Person womöglich dort – kann sich aber auch an einem anderen Ort gesellschaftlich engagieren.
Auf die Frage, ob solche Artikel zu «Nomaden-» oder «Indie-Christ*innen» Menschen nicht sogar von lokalen Kirchen fernhalten, bin ich übrigens in diesem Video: «Was macht eine Kirche aus?» eingegangen.
Fazit
Die beiden Arten, seinen Glauben zu leben, können nicht gegeneinander aufgerechnet werden. Das eine ist nicht besser als das andere. In manchen Lebensphasen ist «Nomaden-Christsein» dran, manchmal findet man Gemeinschaft mit Gott und anderen Menschen in einer Kirche – und manchmal anderswo.
Umgekehrt haben die traditionellen Kirchen nach wie vor viel zu geben. Doch müssen sie auch immer wieder über die Bücher: Ob der gute Kern, um den sie sich drehen, auch in Angebote gepackt sind, die gefragt und relevant sind.
Foto: Barrie Johnson/Unsplash



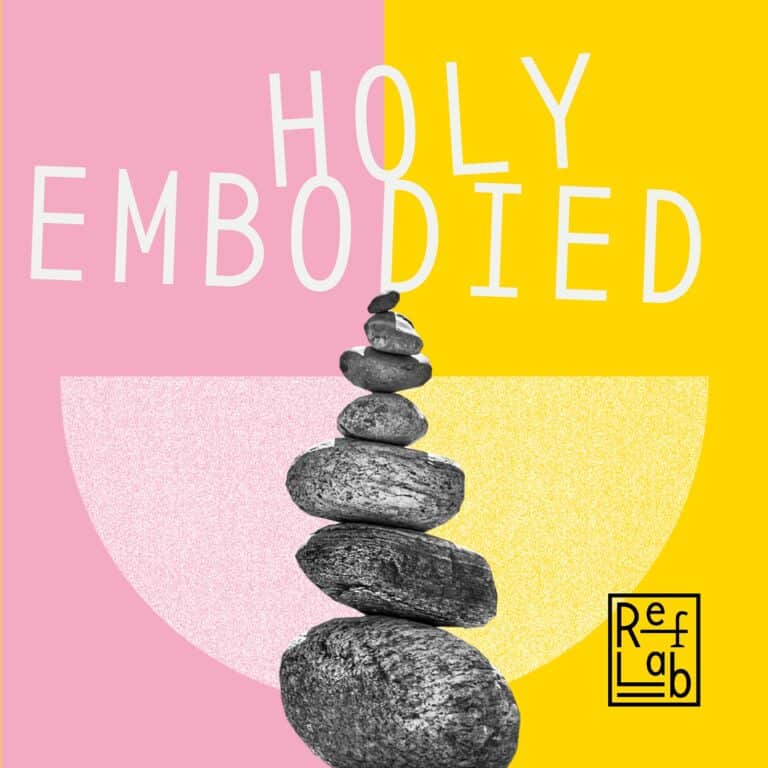




13 Kommentare zu „5 Nachteile am «Indie-Christsein»“
Vielen Dank für deine Artikel, die meiner Meinung nach sehr gut den Nerv der Zeit treffen! Danke auch für die kritischen Überlegungen hier.
Punkt 4 beschäftigt mich auch.
1. Eine meiner Beobachtungen ist, dass sich in diverser dieser lockeren Gruppierungen (digital campfire) vielfach die Schönen, Erfolgreichen und Starken zusammen treffen. Die finden einander toll und es entsteht eine sehr positive Stimmung und super Dynamik. Das finde ich cool. Aber eben, viele fallen durch die Maschen.
2. Eine andere Beobachtung. Vielfach sind es geistlich reife Christen, die sich treffen. Wo ist der Platz für solche, die ganz neu zum Glauben gefunden haben? Oder solche die Gott noch gar nicht kennen? Auch hier, fallen durch die Maschen.
Besteht die Gefahr, dass sich eine Art „Elite“ der Christen trifft? Ist das Leben so voll, dass man sich nur noch „leisten“ kann andere „Elitechristen“ zu treffen?
Dies nur meine Beobachtungen. Gerne würde ich von anderen Beobachtungen hören.
Deinem Fazit, dass man die beiden Arten Glauben zu leben nicht gegeneinander ausspielt stimme ich zu.
Hey Lukas, danke vielmals für deinen Kommentar und das positive Feedback! Ich finde, du schreibst hier sehr wichtige Gedanken. Das ist definitiv eine Gefahr.
Zum Punkt 2: Wenn „Indiechrist*innen“ ihren Glauben auch im Alltag authentisch leben und kommunizieren, sodass Menschen sich das auch wünschen und zum Glauben kommen, bestehen ja bereits diese Beziehungen. Was es hier nicht gibt, wären institutionalisierte „Evangelisationen“, aber mit diesem Konzept haben diejenigen Indiechrist*innen, die ich kenne, ohnehin Mühe…
Liebi Grüess!
Logisch hat alles Vor- und Nachteile. Meines Erachtens wäre die wichtige Frage, was sagt die Bibel dazu, schliesslich ist sie ja der Leitfaden von allen Christ*innen oder? Logisch gibt es auch dort verschiedenen Ansichtspunkte. Jedoch scheint mir die Summe der Aussagen doch eher auf eine verbindliche Gemeinschaft hinzuweisen. Wir sind ein Leib. Ohne Verbindung mit anderen Gliedern stirbt ein Körperteil ab, das zeigt ja schon unsere Natur. Wir sind Familie, kümmern uns umeinander, nehmen Anteil, ermutigen und ermahnen und ergänzen einander. Ich glaube das war Gottes geniale Idee von Kirche und das hat sich nicht geändert, wird wahrscheinlich sogar immer wichtiger! Wir brauchen einander, auch wenn es nicht immer «lustig» und manchmal sogar recht anstrengend ist! 🙂
Liebe Tina, danke für den Kommentar! Ich bin völlig mit dir einverstanden: Genau aus diesem Grund halte ich „Indie“ für einen nicht optimalen Begriff, weil er Unabhängigkeit suggeriert. Das stimmt weder theologisch, wie du ja auch schreibst, noch in der Realität – niemand ist alleine unterwegs. Ich glaube jedoch, dass es braucht dafür nicht zwingend das sehr statische, institutionelle, enge Kirchenmodell braucht, das heute Standard ist. Auch die Christ*innen im NT waren „nomadisch“ unterwegs: Einige von ihnen reisten tatsächlich umher (Paulus, Phöbe, Lukas…), die anderen fühlten sich untereinander verbunden, auch wenn sie an verschiedenen Orten lebten. So stelle ich mir Nomadenchristsein vor: Dass man ein Zusammengehörigkeitsgefühl hat mit anderen Christ*innen, aber in kleinräumigeren Beziehungen verwurzelt und in diesen verbindlich miteinander unterwegs ist (z. B. Hauskreis, Freundschaften, Familie…).
Das sehe ich genau so. Ich war lange Jahre in Afrika. Wir sind ein Leib in Jesus Christus 🙏
Gäbe es ohne Indie-Christ*innen überhaupt ein Wachstum institutioneller christlicher Angebote? Nein! Braucht es Mut und Vertrauen, immer wieder auf neue Netzwerke zu hoffen? Ja! Gibt es Widerstände und Zweifel? Ja! Bist du stark, neugierig, Freund persönlicher Herausforderungen? Go for it! Gemeinschaft immer wieder herstellen und vorleben ist der Preis. Das ist elitär. Ja. Aber es ist so hoffnungsvoll, der eigenen Bestimmung hinterher zu laufen. Jesus sagt: Ich bin der Weg. Alles weitere findet sich.
Danke für den Kommentar!
Vielen Dank für diesen reflektierten und ehrlichen Beitrag.
Zwei Seelen schwingen beim Lesen in meiner Brust.
1.) Ich kann aus individueller Perspektive gut nachvollziehen, dass es Gründe gibt, sich keiner Gemeinde anzuschliessen. Z. B. eine bestimme Lebensphase in der andere Themen im Vordergrund stehen. Oder auch die Erfahrung, dass ein Mensch in seiner Art und Lebenshaltung sich in vielen Gemeinden nicht wohlfühlt. Es ist ja z. B. bekannt, dass landeskirchliche Gemeinden mit ihrer Prägung weithin nur noch 1 1/2 Milieus erreichen. Die Empfinden „ICH“ komme da nicht vor, kann ich gut nachvollziehen. Wenn man/frau auch noch ein eher distanziertes Verhältnis zu freikirchlich-evangelikalen Strömungen hat (Bibelverständnis, moralisch-ethische Positionen), dann wird es schwierig. Die Möglichkeit über Podcasts, youtube, Diskussionsforen Gleichgesinnte zu finden ist ja heute gut möglich. Manchmal entwickeln sich daraus auch reale Begegnungen, Gruppen usw.
Diese Gründe sind für mich sehr nachvollziehbar. Ich als Gemeindepfarrer profitiere z. B. sehr viel von den sozialen Medien. Konkret z. B. von Worthaus, Reflab (speziell Ausgeglaubt), den Podcasts mit Thorsten Dietz oder dem Moveacast von Martin Benz.
2) Meine „zweite Seele“ als Gemeindepfarrer schmerzt es, weil ich empfinde das die Zahl der „Indie-Christ*innen“ zunimmt. Ich erlebe sie meistens als punktuelle Teilnehmer*innen bei interessanten Formaten. Manchmal ergeben sich sehr gute und interessante Gespräche. Oft sind es sehr reflektierte Menschen, die gute Gründe haben, warum sie sich nicht binden. Aber zugleich macht es mich traurig. Ich bin vor vielen Jahren Pfarrer geworden weil ich ich lebensrelevante, ansprechende und anziehende Kirche bauen wollte. Das ist noch immer meine Motivation. Aber wie Viele leide ich daran, dass es immer schwieriger wird Freiwillige zu gewinnen und/oder das die Freiwilligen, oft nur aus bestimmten Milieus kommen. Der Versuch eine moderne, zeitgemässe Kirche zu bauen scheitert manches Mal schon daran, dass es zu wenig Mitstreiter*innen gibt. Dann macht mich das Lob von „Indie*christinnen, die punktuell auftauchen und sich danach bedanken, wie toll es war, hässig. Denn ich würde mir manche von ihnen als Mitstreiter*innen wünschen, um frischen Wind in die Kirche zu bringen. Aber sie entziehen sich der Verantwortung! Dann kommt bei mir schon der Gedanke auf: „Ihr schöpft nur den Rahm ab, bedankt Euch dafür wie toll es ist, aber seid nicht bereit Euch ein bischen einzubringen, während andere sich abschuften“. Mir ist klar, dass diese Gedanken einseitig sind. Wie oben gesagt, ich verstehe die Gründe von „Indie-Christ*innen*.Aber wenn nur ein Teil dieser spannenden, oft so anders als typisch kirchlichen Persönlichkeiten sich einbringen würden und Verantwortung übernähmen , sähe dann Kirche nicht vielleicht ganz anders aus? Wäre Veränderung dann nicht an vielen Orten einfacher?
Lieber Uwe, danke für deinen Kommentar. Ich verstehe, dass du diese Art, den Glauben zu leben, als Gefährdung für deine eigene Arbeit erlebst, glaube aber, hier liegt ein Missverständnis vor, wer überhaupt Nomaden-/Indiechrist*innen sind. Gemeint sind nicht die typischen „Kirchenfernen“, die sich nach der Konfirmation ausklinkten und höchstens noch einzelne Angebote besuchen. Sondern Leute, die sich jahre- bis jahrzehntelang in Gemeinden (häufig Freikirchen) sehr engagiert haben, aus diversen Gründen (am häufigsten zwischenmenschliche Enttäuschungen oder theologische Diskrepanzen) jetzt nicht mehr dabei sind und jetzt ihren Glauben in anderen, kleineren Gemeinschaften leben. Kann das sein, dass wir da an zwei unterschiedliche Gruppen von Menschen denken?
Liebe Evelyne,
Nein. Ich glaube das Missverständnis liegt auf deiner Seite. Möglicherweise habe ich mich auch nicht klar genug ausgedrückt oder der Hinweis auf die Milieus, die die Landeskirche überhaupt noch erreicht hat dich an Kirchendistanzierte denken lassen. Aber diese Gruppe hört grösstenteils keine christlichen Podcasts, Youtube- Kanäle, Social Media usw. Ich rede exakt von der Personengruppe, die Du beschreibst.
Das sind einerseits Menschen mit teilweise jahrelanger Gemeindeerfahrung, die durch Streitigkeiten, Gemeindespaltungen, persönliche Verletzungen und inhaltlicher Konflikte die Nase voll haben von Kirche – und auf Abstand gegangen sind. Da gibt es noch die eine oder andere lockere Verbindung (wie das gelegentliche Auftauchen bei bestimmten Events) oder z. B. ein Hauskreis, der sich aus Personen verschiedenster christlicher Hintergründe zusammensetzt -oder/und das Hören/Schauen ausgewählter christlicher Social Media-Formate.
Darüber hinaus erlebe ich eine zweite Gruppe von Indie*Christinnen, die sich nicht aufgrund von Konflikten herausgezogen haben, sondern das „nomadisierende“ schon immer gelebt haben. Z. B. kenne ich eine Familie, die zwischen 2 landes- und freikirchlichen Gemeinden pendelt und sich an verschiedenen Stellen das Eine- oder andere abholt, aber sich nirgends wirklich einbringt. Eine ähnliche Entwicklung erlebe ich bei einem Teil der Jungen Erwachsenen, die eine Art „Church Hopping“ betreiben, aber nirgendwo richtig dazu gehören.
Diese Entwicklungen nehmen – das ist mein subjektiver Eindruck – zu. Gerade die Verletzungsgeschichten kann ich gut nachvollziehen.
Zugleich finde ich es schade, dass es selten gelingt, dass „Indie“*Christinnen andocken. Das hat mit dem Zustand der „real existierenden“ Gemeinden zu tun, aber auch mit der „Bindungsscheu“ der Indies.
Ich erlebe sie übrigens nicht als „Gefährdung“ für meine Arbeit. Sie sind ja nicht meine Gegner. In dieser Beschreibung finde ich mich überhaupt nicht wieder. Es ist eher ein trauriges Bedauern darüber, weil ich glaube, dass gerade Menschen mit solchen Erfahrungen, mit einem oft überdurchschnittlichen Reflexionsvermögen den Gemeinden viel zu geben hätten – und dass es durche ihre Mitarbeit gelingen könnte Kirche zu verändern.
Ich bin überzeugt, dass es heute und in der Zukunft beides brauchen wird – örtliche Gemeinden mit verbindlicher Gemeinschaft und Beteiligung und die alternativen Kirchenformen (fresh expressions).
Mir geht es in meinen Kommentaren darum „Indie*Christinnen“ einmal zu spiegeln, wie es sich für einen engagierten Gemeindepfarrer anfühlt, der etwas verändern will zu einer offenen zeitgemässenen und menschenfreundlichen Kirche, wenn er zunehemend die Erfahrung macht, dass Christ*innen sich nicht mehr auf Engagement/Verantwortung einlassen können/möchten.
Lieber Uwe, danke für die Präzisierung. Einerseits kann ich das gut verstehen. Weil ich ja selber in der Ausbildung zur Pfarrerin stecke, ist das auch ein Dilemma, das mich persönlich betrifft. Und ich weiss, dass grundsätzlich in vielen Gemeinden eine grosse Offenheit gegenüber neuen Ideen besteht.
Andererseits sind ja viele Indie-Christ*innen genau Leute, die sich sehr lange und intensiv engagiert haben, bevor sie (aus diversen Gründen) „ausgestiegen“ sind. Indem du uns absprichst, Verantwortung zu übernehmen, tust du denjenigen, die ich kenne, Unrecht. Ich weiss, das Kirche nur über Freiwilligenarbeit überhaupt funktioniert. Aber gerade die Generation zwischen Konf und Familiengründung (eine Lebensphase, die heute gerne 10-20 Jahre umfasst) wird oft ausschliesslich als potenzielle Freiwillige gesehen: Einfach nur dabeisein liegt nicht drin. Ich finde, es müsste umgekehrt gehen: Dass Leute sich mit der Kirche identifizieren und dadurch auch bereit werden, sich zu engagieren. Und wenn ersteres fehlt, wie bei den Beispielen, die du nennst, warum nicht mal nachfragen, warum das so ist?
Schlussendlich glaube ich, dass der Schlüssel bzw. auch die Crux ein tragfähiges Beziehungsnetzwerk ist. Wenn Beziehungen zur Gemeinde nicht vorhanden sind oder sich aus verschiedenen Gründen nicht bilden lassen, fehlt die Identifikation und somit auch die Bereitschaft, sich zu engagieren. Letzte Woche schrieb mir eine junge Frau auf Instagram, sie sei Mitglied einer reformierten Kirchgemeinde, aber die einzige in ihrem Alter, und für sie seien die Angebote der Gemeinde alle so verstaubt, dass sie eigentlich nicht mehr hingehen mag. Dort fehlt offenbar dieses Netzwerk. In Gemeinden mit vielen jüngeren Menschen ist hingegen oft gerade das der Anziehungspunkt, der fast zum Selbstläufer wird. Und umgekehrt war die fehlende „soziale Kapazität“ für mich der ausschlaggebende Punkt, nach einem Umzug vor ein paar Jahren nicht mehr in eine Gemeinde zu gehen: Ich hatte so schon Mühe, meine Freundschaften angemessen zu pflegen, dass ich einfach keine Zeit mehr hatte für ein zusätzliches, neues Beziehungsnetzwerk. Und das erwartete zeitliche Investment in der betreffenden Freikirche (der halbe Sonntag jede Woche plus zusätzliches Engagement) war für mich ein zu hoher Preis, um das Gefühl zu erhalten, dazuzugehören.
Ein super Tipp, den ich übrigens vor einer Weile gelesen habe, ist das Arbeiten in „Staffeln“ statt Mitarbeit auf unbestimmte Zeit. Hier der Link: https://www.juhopma.de/warum-ich-ab-heute-im-netflix-zeitalter-arbeite/ Vielleicht kannst du damit was anfangen – und auf dieses Prinzip liessen sich vielleicht auch die „Indies“ ein, die bei dir mit gewisser Regelmässigkeit reinschauen.
Mir selber fehlt bei manchen kirchlichen Angeboten, für die ich angefragt wurde, die Identifikation mit der Vision: Man will „den Laden am Laufen halten“ und neue Menschen in die Kirche holen, aber warum? Das ist mir oft nicht klar, es muss doch um mehr gehen als um Selbstzweck.
Ich lass das mal so – und wünsche dir einen schönen Abend. Liebe Grüsse!
Das ist völliger Unsinn. Mir als Praktizierender eines kirchenfreien Christentums fehlen weder andere Gläubige noch theologische Impulse (gibt’s im Internet oder in Buchform) oder das Singen und ich habe auch kein schlechtes Gewissen. Meine Gottesbeziehung ist sogar viel intensiver geworden, z.B. durch regelmässiges Pilgern (Jakobsweg etc.).
Sorry, „völliger Unsinn“ ist das nicht, sondern einfach individuell. Die fünf Punkte sind Dinge, die ich so erlebe oder von anderen Nomadenchrist*innen höre. Sie haben auch wenig mit der Intensität des Glaubens bzw. der Gottesbeziehung zu tun.
Trotzdem danke für den Kommentar und den Hinweis aufs Pilgern, das ist eine schöne Praxis!