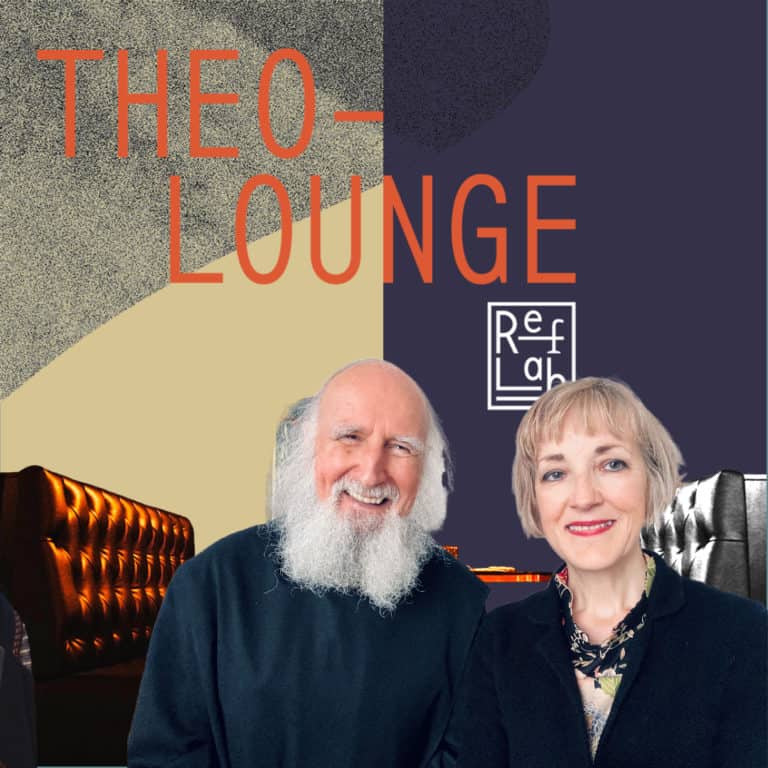Christliche Spendenorganisationen haben in den zurückliegenden Jahrzehnten Prozesse atemberaubender Professionalisierung hingelegt. Was aus Initiativen Einzelner oder kleiner Gruppen heraus entstanden ist, oft vor dem Hintergrund konkreter Notlagen im Zusammenhang mit Kriegs- und Nachkriegssituationen, ist zu charitativen Multinationals und Global Playern mit mehrstelligen Millionenbudgets angewachsen.
Im Internet präsentieren sich Organisationen wie «Misereor» (rund 200 Millionen Euro Budget jährlich), «Brot für die Welt (mehr als 300 Millionen Euro) oder das Schweizer «HEKS – Hilfswerk der evangelischen Kirchen Schweiz» (knapp 80 Millionen CHF) als Big Player, die die weltweiten Katastrophenhotspots im Auge haben. In einem zunehmend kompetitiven Markt konkurrieren sie miteinander um Spendenmillionen.
Ihr vormals christliches Gepräge streifen internationale Spendenorganisationen mehr und mehr ab. So nennt sich der niederländische Zweig von «Pax Christi» etwa nur noch «Pax». Die Begründung: Das «Christi» habe Grossspender aus der Wirtschaft gestört. Diese bevorzugten weltanschauliche Neutralität, heisst es.
Das Schweizer HEKS behält den kirchlichen Namen entgegen diesem Trend auch nach der Fusionierung mit «Brot für alle» am 1. Januar 2022 bei.
Aber hat nicht auch beim Hilfswerk der evangelischen Kirchen der Kirchenbezug immer mehr an Bedeutung verloren? Nur noch rund 14 Prozent der Mittel stammen laut dem aktuellen Jahresbericht aus Kantonalkirchen, Kirchgemeinden und weiteren kirchlichen Organisationen (insgesamt 11,3 Mio CHF). Von Privatpersonen, darunter sicher zahlreiche Christ:innen, kommen jährlich immerhin rund CHF 16,7 Mio (21%).
Verschärfte Konkurrenz
Peter Merz, der Direktor von HEKS, erklärt auf RefLab-Anfrage, dass sich das Hilfswerk «in einem sehr kompetitiven Marktumfeld behaupten» müsse. Gerade deshalb bleibe es darauf angewiesen, dass die Kirchen der Schweiz und «ACT Alliance», ein internationales Netzwerk von mehr als 140 kirchlichen Partnerhilfswerken, das Werk weiterhin unterstützen und mittragen. «Die Fusion ändert nichts an unserer Herkunft, der EKS als Stifterin und ihres an HEKS übertragenen Mandates. Die EKS beauftragt uns weiterhin als ihr Werk, diakonische Arbeit für benachteiligte Menschen in der Schweiz und weltweit zu leisten.» Und dies dürfe sich auch im Namen spiegeln.
Auch die Bezeichnung «Hilfswerk» bleibt erhalten. Ein Namenswechsel im Zuge der Fusionierung mit «Brot für alle» habe nicht zur Diskussion gestanden, sagt Merz. Sowohl der Kirchenbezug als auch die Bezeichnung «Hilfswerk» seien
«Teil der über Jahrzehnte entwickelten und gewachsenen Identität. Die Zukunftsfähigkeit eines kirchlichen Hilfswerks hängt allerdings nicht vom Namen ab, sondern von dessen Professionalität auf allen Ebenen und der Fähigkeit, gesellschaftliche, politische und ökonomische Veränderungen zu antizipieren und darauf mit innovativen Ansätzen zu reagieren. Gemeinsam mit unseren Auftraggebern und Projektpartnern, davon die Mehrheit ausserhalb der Kirchenstrukturen, entwickeln wir deshalb immer wieder neue Projekte und Programme.»
Innovative Geschäftseinheiten im Projektportfolio seien beispielsweise «HEKS-Visite» in der Region Zürich/Winterthur, der Dolmetschdienst «HEKS Linguadukt» in den Regionen Aargau/Solothurn sowie Basel oder ein Förderprogramm gemeinsam mit der HEKS-Partnerorganisation «Impact Hub Phnom Penh» in Kambodscha.
Wurzelbehandlung
Die Distanzierung von christlichen Wurzeln bei vielen anderen internationalen Spendenorganisationen hat neben wirtschaftlichen Motiven einen tieferen Grund: Christliche Mission, als Vorläufer heutiger Spendenorganisationen, wird im Kontext postkolonialer Aufklärung vor allem als Teil einer Gewalt- und Unterdrückungsgeschichte wahrgenommen. Aus dieser Perspektive erscheint der Christentumsbezug grundsätzlich problematisch.
Vor kurzem ist eine umfangreiche Geschichtsaufarbeitung erschienen: «Die Bekehrung der Welt. Eine Geschichte der christlichen Mission in der Neuzeit» von Bernhard Maier. Der Religionswissenschaftler arbeitet anhand historischer Belege heraus, wie seinerzeit von Monarchen eingesetzte koloniale Landesherren sowohl für Missionierung als auch für Ausbeutung einheimischer Arbeitskräfte in Überseegebieten zuständig waren.
Durch diese Verkopplung hätten «Betroffene Christianisierung und Eroberung als zwei Seiten ein und derselben Medaille wahrnehmen» müssen. Missionierung, zum Teil sogar Zwangsmissionierung, sei mit Zwangsarbeit einhergegangen und hätte gleichzeitig die «Unterwerfung der Welt» moralisch flankiert.
Vor diesem schwer zu begreifenden, perfiden Hintergrund ist nicht verwunderlich, dass, wenn internationale humanitäre Spendenorganisationen heute von «mission» und «vision» sprechen, dies im Sinn der Formulierung von Unternehmenszielen geschieht, aber kaum mit Blick auf eine wie auch immer geartete Christusmission.
Wie ihre missionierenden Vorläuferinstitutionen sind aber auch heutige Organisationen Teil einer Welt mit Strukturen, die, nunmehr neokolonial, Gerechtigkeitsbestrebungen häufig entgegenstehen.
Und beim Blick in die jüngere Geschichte lässt sich schwer leugnen, dass Demokratieexporten des Westens mitunter nicht nur missionarische Züge anhafteten, sondern im Zuge gezielter Interventionen auch Gewaltaspekte. In Zivilgesellschaften ausserhalb Europas gibt es nach Jahrzehnten politischer und ökonomischer Einflussnahme des Westens grundsätzliche Vorbehalte gegen Hilfe des Weissen Mannes.
White Saviorism
Regula Hafner, die die Entwicklungszusammenarbeit des HEKS mit Afrika leitet, hat kürzlich in einem Ref-Interview mit der Überschrift «Kolonialismus beeinflusst unsere Arbeit nach wie vor» festgestellt, dass Intellektuelle im Global South dem Modell der Entwicklungskooperation (früher Entwicklungshilfe) heute vielfach skeptisch bis ablehnend gegenüberstünden.
In der postkolonialen Kritik steht insbesondere auch die Bildpolitik von Spendenorganisationen. Diese stecken in einem Dilemma: Empathie, schlechtes Gewissen und Spendenfreude lassen sich am ehesten mit drastischen Armutsbildern («Elendpornos», «Hungeraugen») wecken. Genau diese Bilder aber zementieren (schwarze) Opfer- versus (weisse) Retterrollen.
Gegen die oft unbewusste Fortschreibung von Rassismen hilft selbst die Betonung «menschlicher Würde» wenig, die viele Spendenorganisationen wie ein Banner vor sich hertragen.
Carolin Philipp hat vor einigen Jahren am Beispiel von «Misereor» und «Brot für die Welt» beispielhaft herausgearbeitet, dass schwarze Menschen in Kampagnen durch ihre Lebensumstände bestimmt werden, Weisse hingegen durch ihre Lebensleistungen. Insgesamt würden Schwarze Menschen als passiv beschrieben und Repräsentant:innen aus dem Westen übertönten die Armen.
Misereor und andere Organisationen haben das Problem von «White Charity» oder «White Saviorism» erkannt, sie vermeiden in Kampagnen drastische Elendsbilder und sensibilisieren und schulen ihre Mitarbeitenden in «Critical Whiteness Studies» und «Kritischer Rassismusforschung».
Jenseits weisser Religion
Das Problem des inhärenten Rassismus reicht tief und ist selbst dort anzutreffen, wo die besten Motive angenommen werden dürfen. Auch in den Kirchen und der Theologie. Theolog:innen wie Maureen H. O’Connell fordern daher eine Kirche «jenseits weisser Religion».
Mit Blick auf die internationale humanitäre Arbeit finde ich interessant, dass Religionsbezug nicht durchwegs als Störfaktor wahrgenommen wird. Bei der Arbeit in stark religiös geprägten Gesellschaften, etwa muslimischen, machen humanitäre Dienstleister die Erfahrung, dass es Gespräche erleichtern kann, nicht aus einem weltanschaulichen Nirgendwo heraus zu reden.
Anerkennung echter Differenz kann ohnedies nicht aus einem vermeintlich neutralen Ort heraus glücken, sei es ein säkularer Ort, der Raum der Wissenschaft oder ein abstrakter Humanismus – weil jede Neutralität verdächtigt werden kann, mit einer Partikularität im Bündnis zu stehen.
Das Narrativ der «Zivilisierung der Welt» ist heute so anachronistisch wie das der Missionierung. Das Lernpensum ist nicht den «Anderen», sondern uns selbst aufgeben. Wir müssen uns vom Weisse-Retter-Syndrom lösen und der kolonialen Gewaltgeschichte ins Auge sehen, so wie sie ist: wenig schmeichelhaft bis verheerend für unser christliches Image.
Werke brauchen Kirchen
Was kommt nach der Rettung der Anderen? Vielleicht die eigene Rettung? Aber ist es nicht ohnehin so, dass sich mein Christsein letztendlich nur als Dienst am Nächsten beweisen kann? Dass all mein christliches Bemühen, mein Beten, Meditieren, Pilgern, Fasten etc. nichts ist, gar nichts, ohne diesen Beweis? Dass also die Anderen mich retten? So gesehen geht es nicht um Geben und Nehmen, sondern um wechselseitiges Geben.
Der amerikanische Theologe Timothy Keller erzählte in einem seiner Vorträge, die Online eine Vielzahl von Menschen erreichen, dass ihm und seiner presbyterianischen Gemeinde in Manhattan plötzlich dämmerte, wie essenziell gelebte Nächstenliebe für das Christsein sei.
Sie sind hinausgelaufen und regelrecht dankbar gewesen, wenn sie Menschen Hilfestellungen geben konnten.
Aus dem Dargelegten lässt sich folgern: Humanitäre Spendenorganisationen brauchen weiterhin die Kirchen, wollen sie nicht zu blossen Social Businesses werden, die in Konkurrenz mit anderen Social Businesses das schlechte Gewissen Bessergestellter bewirtschaften. Und Kirchen brauchen Spendenorganisationen, mit denen sie sich identifizieren können: in einer zunehmend krisenhaften Welt sogar mehr denn je.
Porträt: 75 Jahre Hilfswerk der evangelischen Kirchen Schweiz
Pilatus, Alpnach, Schweiz, 2018; Photo by Ricardo Gomez Angel on Unsplash