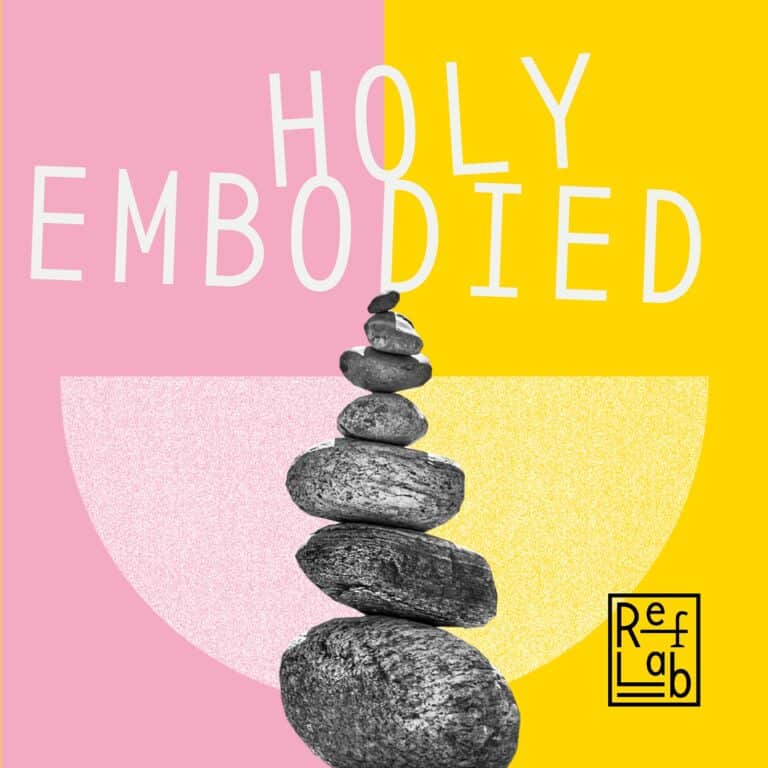Sozialisiert bin ich ganz und gar gut schweizerisch reformiert: Aufgewachsen mit Sonntagschule, den sporadischen Kirchenbesuchen und Konfunterricht. Dorthin wollte ich ehrlichweise vor allem, weil die coolen Jungs vom Dorf auch gingen, die mir viel spannender vorkamen als jene vom Gymi. Hin und wieder kifften wir nach dem Unti. Aufregend, da verboten und neu. Später dann, als es um die Wahl eines Studiums ging, hatte all das jedoch wenig damit zu tun (und das Kiffen und die Dorfbuben waren längst nicht mehr interessant). Ich entschied mich für reformierte Theologie, weil die Frage nach dem „Warum“ in meinem Leben schon früh so richtig relevant war. Und ich immer spürte: Irgendwie gibt’s da mehr.
Auf der Suche nach einer Tradition
Das Studium, ihr habt es vielleicht bereits hier in «Holy Embodied» gehört, konnte das grosse warum aber nöd wüki beantworten. Also ging ich weiter, dachte, «ja guet, demfa nöd im Chrischtetum». Fand an anderen Orten Antworten. Im Yoga, in der Meditation. Aber auch bei diesen beiden fiel es mir schwer, mich einer bestimmten Tradition anzuschliessen. Ashtanga Yoga war mir zu brutal, zu viel Guru-Kult (der Begründer Patthabi Jois stand 2018 wegen Missbrauchsvorwürfen in den Schlagzeilen), Zen-Meditation zu wenig humorvoll. Auch die anderen Linien sprachen mich nicht so sehr an: alles zu eng.
In diesem Zusammenhang war ein Besuch in einem Ashram in Indien mega hilfreich: Eine Reportage fürs Radio führte mich zu diesem interreligiöser Ashram, gegründet von einem Benediktinermönch Mitte des letzten Jahrhunderts, der die hinduistische Umgebung in Südindien in seine Arbeit integriert. Der dortige Leiter, der Mönch John Martin Sahajananda Kuvarapu, sagte zu mir:
«Religion ist sowas wie deine Airline, mit der du an einen Ort fliegst. Wenn du angekommen bist, kannst du sagen ‘danke Air Christentum oder Air Hinduismus’ – aber du musst aussteigen und weiter gehen.»
Er sprach von einem Berg, der dann auf uns warte, den wir mit verschiedenen Praktiken weiter erklimmen könnten. Aber alles, auch jegliche Spiritualität, falle irgendwann weg. Religion, so der römisch-katholische Mönch (!), bringt dich nur zu einem gewissen Punkt. Genauso spirituelle Praktiken. Dann musst du ohne sie weiter. Was er damit anspricht, ist die Verleitung, sich mit einer bestimmten Linie oder Tradition zu identifizieren. Ein Verharren in einer Pose quasi. Was nicht schlecht ist oder so, aber wenn du ganz frei sein willst, ist es ehnder hinderlich dich in einer Identität einzurichten.
In diesem Sinne bin ich nicht reformiert. Ich bin aber auch nicht Hindu oder Buddhistin, ich bin keine Yogini. Ich bin und fertig.
Der Körper als lebendiges Gebet
Glücklicherweise tauchten für mich zu unterschiedlichen Zeitpunkten sowohl im Yoga als auch im Meditieren Lehrerinnen auf, die die Traditionen chli über den Haufen werfen und in Frage stellen. Beide nehmen den Körper als Ausgangspunkt, fürs Bewegen, fürs Sitzen in der Stille. Nicht Regeln, nicht Dogmen, nicht «ist so weil wir das immer schon so gemacht haben». Einzig und allein der Körper ist es, der uns leitet in der Bewegung, aber auch in der Stille.
Was sich für manche vielleicht anhört wie «jedem Impuls des Körpers nachgeben und einen animalischen Zustand verfallen», ist nicht so. Denn auf den Körper hören, heisst nicht jedem Seich nachgeben. Viele vermeintliche Signale des Körpers werden von dem produziert, was Eckhart Tolle «painbody» nennt: eine Ansammlung von Konditionierung aus frühster Kindheit und verdrängte Verletzungen. Oftmals essen wir zum Beispiel, weil uns langweilig ist, weil wir traurig sind. Wir werden wütend, weil jemand mit einem harmlosen Kommentar die Stimme der Eltern triggert: «Jetzt tu‘ doch nicht so, mach nicht so ein Theater» – oder wie die auch immer klingen. Je mehr wir jedoch diese Mechanismen durchschauen, desto mehr hören wir die tatsächlichen Bedürfnisse des Körpers, unseres Wesens.
Wenn man mich also nach meiner Religion oder Linie fragt, müsste ich wohl «Körper» antworten … Körper nicht als wirres, animalisches Gehäuse, sondern ehnder als lebendiges Gebet. Man möge die frommen Worte verzeihen. Sie sind vielleicht gar nicht so fromm: Lebendiges Gebet heisst für mich, alles ist eine Option, alles liegt auf dem Tisch, wie meine Lehrerin sagt. Zigaretten, Wein, Sex, Fleisch, Schoggi, alles. Die Schwierigkeit liegt jedoch darin, zu durchschauen, was in mir zum Beispiel die Schoggi will. Ist es ein echtes Bedürfnis des Körpers oder ist es eine Kompensation für igendöppis? Ech. Es braucht Einiges an Bereitschaft und Aufmerksamkeit, so nah dabei zu bleiben im Moment. Ja.
Doch reformiert
Aber, und damit komme ich zum «ich bin ebe doch reformiert»: Ich höre auf den Moment und überlasse mein Leben nicht einer Autorität. Niemand muss mir Gott übersetzen, ich kann sie selber hören. So wie die Reformation die Bibel in die Sprache der Leute übersetzt hatte, verstehe ich heute meinen Körper quasi als Übersetzer. So wie der damalige Übersetzungsprozess den Menschen mehr Selbstbestimmung gab, schafft dieser Schritt über oder in den Körper eine enorme Freiheit. Eine, die ämel ich nicht missen möchte. Eine, die auch mal anstösst und aneckt. Aber das ist in Ordnung. Ich muss nicht so oder so sein, damit ich geliebt bin. Denn als reformierte Theologin weiss ich, dass ich gerechtfertigt bin. Ohne „Wenn und Aber“.