»Seh’ ich gut aus?«, habe ich mich kürzlich gefragt. Ich hatte ein paar Selfies für den Hausgebrauch geschossen und anschliessend skeptisch überlegt, ob ich etwas davon behalten möchte. Auf einigen Aufnahmen fand ich das Licht ungünstig, auf anderen mochte ich mich aus irgendwelchen Gründen nicht. Ein paar schienen o.k., konnten aber nicht verleugnen, was sie waren: narzisstische Bespiegelungen. Ich habe die gesamte Serie mit einem peinlichen Gefühl wieder gelöscht.
Auf dem Hashtag #womensupportingwomen veröffentlichen Frauen derzeit Selfies, die vor Eitelkeit nur so triefen. Das Ganze ist als ›Challenge‹ geframt und funktioniert auf Social-Media-Kanälen als eine Art Kettenbrief. Teilnehmerinnen klicken auf #ChallengeAccepted, posten Schwarzweiss-Selfies und hinterlassen allgemein gehaltene Statements wie: »Dein Leid ist unser aller Leid. Wir sind alle eins« oder »Stand up for each other«. Gestartet wurde die Aktion offenbar vor einigen Wochen als Reaktion auf Femizide in der Türkei und Millionen Frauen machen weltweit mit.
Empowering durch Bilder
Mit dem globalen Aufruf, Selfies zu posten, greift die Aktion eine in der Netzwelt schon länger bekannte Form auf, die auch als ›Selfie-Feminismus‹ bezeichnet wird. Die Idee ist ein Empowering durch Bilder, die nicht vom männlichen Blick (›male gaze‹) bestimmt sind. Es geht um die Erzeugung alternativer Images von Weiblichkeit jenseits verobjektivierender Darstellungsmuster.
Wie schwer es aber offenbar fällt, aus dem sexistischen Schema auszubrechen, führt #womensupportingwomen unfreiwillig vor Augen. Rehaugen, Schmolllippe und tiefes Dekolleté: Viele Frauen imitieren Starposen der Unterhaltungsindustrie.
In den Kommentarspalten von #womensupportingwomen überschlagen sich Komplimente wie ›hübsch‹, ›cool‹, ›sexy‹. Die politische Aktion ist von einer Modewelle ununterscheidbar geworden. Das ursprüngliche Anliegen rutscht in den Hintergrund.
Inzwischen haben sich auch zahlreiche Prominente aus dem Showbusiness wie Jessica Biel, Victoria Beckham, Cindy Crawford oder Kerry Washington ›solidarisiert‹ und es ist ein Wettbewerb um Aufmerksamkeit entbrannt. Prominente aus der Kino- und Musikbranche ernten teilweise tausende Likes von ihren Fans, darunter platte Anzüglichkeiten.
Ein ›dummer Trend‹
Auch Künstlerinnen machen mit, allerdings um sich zu distanzieren. Candice Breitz etwa hat ein Selfie mit Duckface und Froschaugen gepostet und nennt den Trend ›utterly asinine‹, komplett idiotisch. Sie sei eigentlich ein Fan von ›sisterhood‹ und ›popular feminism‹, schreibt die in Berlin lebende Kunstprofessorin, aber was auf dem Hashtag vorgehe, sei lediglich die ›übliche Konkurrenz‹ ums beste Aussehen mittels der schmeichelhaftesten Fotos. »Ich sehe nur einen endlosen Strom von meist glamourösen Schwarz-Weiss-Porträts von meist Cis-Frauen, die meinen Feed blockieren.«
Auch die australische Künstlerin Dzidra Mitchell, die in Zeichnungen und Gemälden immer wieder das Thema selbstbewusster Weiblichkeit umkreist, wundert sich über die Art der weiblichen ›Solidarisierung‹: »Ich fühle mich in keiner Weise davon ›empowered‹. Manche dieser Glam Shots entbehren so deutlich jeglicher aufrichtigen ›togetherness‹, so wenige Frauen sind wirklich präsent.«
Mangel an Persönlichkeit
Tatsächlich lässt #womensupportingwomen nicht nur eine überzeugende Ikonografie der Solidarität vermissen, sondern gerade auch dasjenige, was die Teilnehmerinnen zu demonstrieren meinen: Selbstbewusstsein und Stärke.
Hinter dem forcierten Die-Schönste-sein-wollen scheinen Unsicherheiten und Zweifel des Ungenügens durch, ästhetische Versagensängste und beinharte Massstäbe, die wir Frauen oft an uns selbst anlegen.
Vielleicht ist die Gewalt, die wir uns selbst antun, sogar ein tieferer Grund dafür, weshalb es uns offenbar schwerfällt, überzeugend aufzustehen gegen von aussen drohende Gewalt?
An der so genannten ›Challenge‹ lassen sich auch tieferliegende Probleme globaler Verschwisterung ablesen. So löblich die ursprünglichen Motive sein mögen, als westliche Teilnehmerin gerate ich tendenziell in die altbekannte Schieflage, nämlich als ›white woman‹ ›brown women‹ vor ›brown men‹ schützen zu wollen – eine paternalistische Attitüde.
Dahinter steckt häufig ein Gefühl der Überlegenheit der eigenen Lebensweise gegenüber kulturell und religiös ›Fremden‹ und ›Anderen‹.
Aber welche Freiheit demonstrieren die Frauen bei der ›Black-and-White-Challenge‹? Viele verraten Abhängigkeit vom Gefallenwollen und Angewiesensein auf Komplimente und Lob in Form von Likes. Und wirkt die Freizügigkeit, Lässigkeit und Coolness der Selbstdarstellungen in der millionenfachen Multiplikation nicht ihrerseits zwanghaft? Frauen machen sich zu Werbeträgern einer Lebensweise, die zwar viele Freiheiten garantiert, aber auch Zwänge produziert, beispielsweise den Zwang miteinander zu konkurrieren.
Was für eine Challenge?
Selfie-Feminismus, jedenfalls in der aktuellen Form, erscheint sogar als Gegenteil einer Solidarisierung. Es braucht bei Selfies ja nicht einmal ein Gegenüber, das auf den Auslöser drückt. Bei Selfies behält man die komplette Kontrolle über das eigene Bild und riskiert nicht einmal eine Aussenperspektive, die nicht schmeichelhaft ausfallen könnte.
Selfies sind geradezu der Inbegriff der Selbstbezogenheit und es erscheint grundsätzlich schwierig, sich ausgerechnet über dieses Medium gemeinsam für Schwächere und Verfolgte stark zu machen.
Negativ verstärkend tritt die Ubiquität von Social Media hinzu. Die Ortslosigkeit der Netze begünstigt Dekontextualisierungen und kann den falschen Eindruck gleicher Voraussetzungen wecken. Tatsächlich aber macht es einen qualitativen Unterschied, ob ich als Teilnehmerin von #womensupportingwomen in Afghanistan oder Deutschland sitze. Ein und derselbe Akt kann entweder mutig oder aber wohlfeil und purer Narzissmus sein.
Eine ›Challenge‹ im eigentlichen Sinn ist das virale Social-Media-Ritual nur für Frauen aus Gesellschaften mit restriktivem Sozialkodex und festgelegten Genderrollen.
Wo schon ein unverschleiertes oder auch nur selbstbewusstes Porträt als Regelübertretung betrachtet wird, beweisen Frauen mit ihren Postings Mut.
Das Schlimmste, was dem wohlfeilen Schmolllippenbekenntnis einer US-Amerikanerin, Australierin oder Europäerin zustossen kann, ist: weniger Likes zu ergattern als Rivalinnen.
Photo by Mateus Campos Felipe on Unsplash
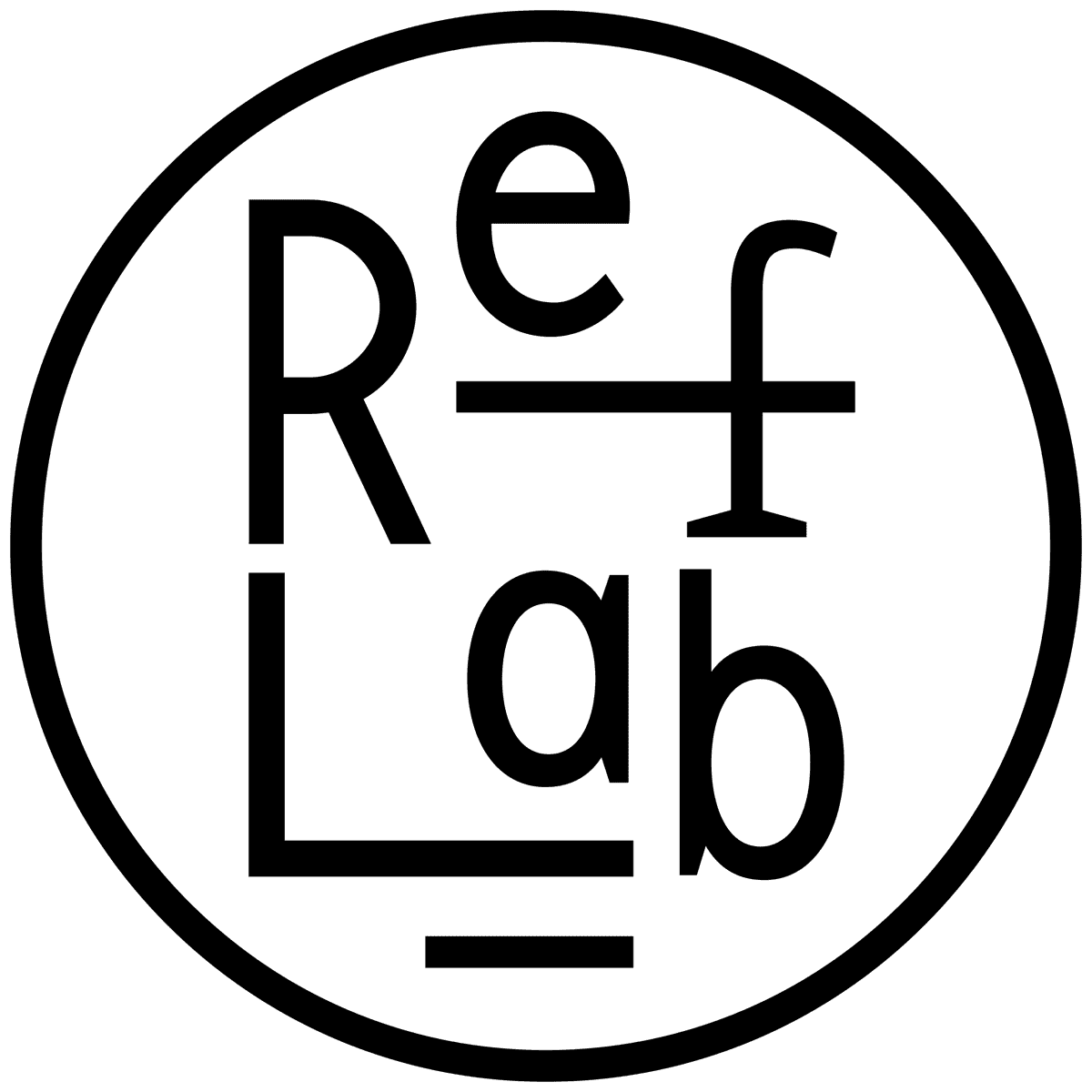





1 Gedanke zu „Schmolllippenbekenntnisse“
Aaaah! Danke fürs Ausformulieren dessen, was ich bloss als vages Nichtsoganzwohlsein gespürt hatte. Schlussamänd zählen ja dann die solidarischen Taten und nicht die Selfies.