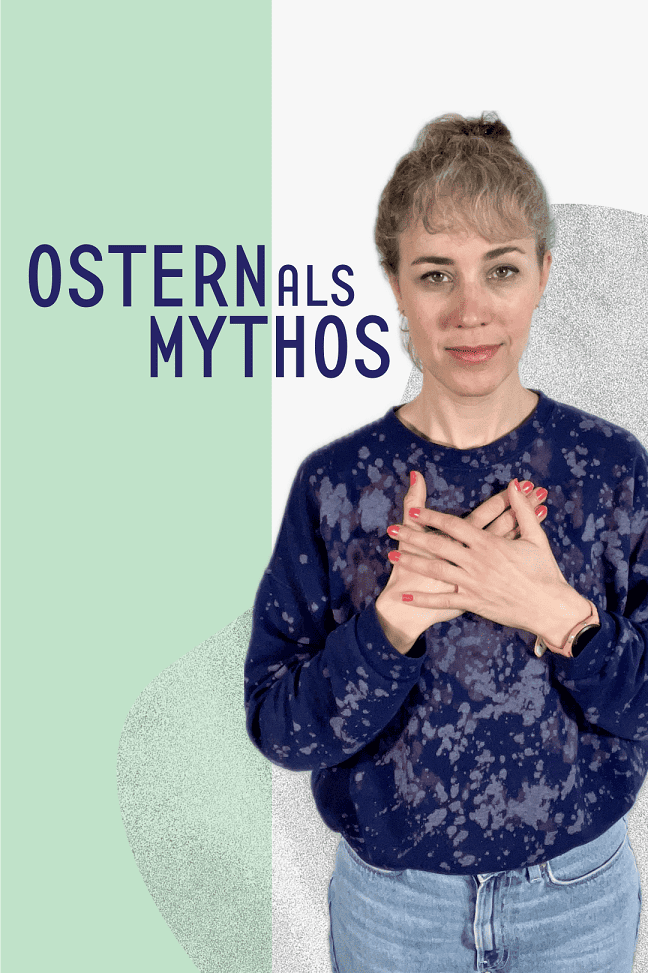Drei Tage Shutdown und danach auferstehen – das wär’s jetzt!
Sie wollten die dritte Infektionswelle durch eine radikale Osterruhe brechen. Ich fand die Idee der deutschen Bundesregierung vom 22. März zunächst erfrischend theologisch. Klang für mich nach Karsamstag. Hat es Gott nicht selbst genauso gemacht? «Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel…», so die entsprechenden Sätze im apostolischen Glaubensbekenntnis.
Drei Tage durch die Hölle, um danach das Fest des ewigen Lebens zu feiern. Im Lockdown das Leben komplett herunterfahren, um es danach endlich wieder hochzufahren.
Ob das die immer wiederkehrende, unabdingbare Pandemiestrategie ist, müssen die Fachleute diskutieren. Nicht wegdiskutieren lässt sich jedoch der über einjährige Hoffnungs- und Kräfteverschleiss. Viele Menschen halten dieses Runter und Rauf kaum noch aus. Weil die Solidarität zerbröselt und etliche bei den Corona-Massnahmen nicht (mehr) mitmachen. Wohl auch, weil sich der freiwillig-verordnete Verzicht nicht gelohnt hat, ausser für diejenigen, die pandemisch Gewinn machen.
Die Zwischenzeit der Corona-Beschränkungen hat sich schrankenlos überdehnt. Sie fühlt sich immer mehr an wie ein gesellschaftlicher Karsamstag mit Endlos- statt Osterschleife.
Ein Zwischentag zum Verplempern?
Der Kirchenjahr-Karsamstag ist für mich bis heute eine Zeit wie zäher Brei. Ich weiss nicht recht, was ich an diesem Zwischentag mit mir anfangen soll. Der Tod Christi schwingt noch nach. Nicht im Sinne von Mel Gibsons Film «The Passion of Christ». So masslos in das Blut und die Folter des Gekreuzigten einzutauchen, tut mir nicht gut. Passioniertes Erinnern und Fühlen geht nicht auf Knopfdruck.
Wenn, dann packt mich eher eine Traurigkeit über all das, was bei mir selbst – und vermutlich ebenso da draussen – überhaupt nicht zum Leben taugt. Auch ein heiliger Schrecken darüber, dass Gott selbst den lebensverderbenden Mächten dieser Welt zum Opfer fällt.
Aber zugleich zieht es mich raus aus dieser lähmenden Grabesstille. Ostern lockt, vor allem natürlich, wenn das mit der Friedhofstimmung nicht funktionieren will. Die Hoffnung, dass ein anderes und neues Leben möglich ist, und zwar ganz geerdet und konkret. Die letzten Jahre habe ich dann – eher früher als später – das Auto gereinigt und die Räder gewechselt. Eines der Übergangsrituale von Passion auf Aktion, um endlich Ostern einzuläuten.
Für eine Aufwertung des Karsamstags
Egal ob es der pandemische Karsamstag oder der im liturgischen Kalender ist, beide stehen nicht hoch im Kurs. Die evangelische Theologie selbst hat schon manche Gründe vorgebracht, den Karsamstag zu vernachlässigen. Kaum jemand tat das so ungeschminkt wie Rudolf Bultmann vor achtzig Jahren:
«Wer weiß, daß er nach drei Tagen auferstehen wird, für den will offenbar das Sterben nicht viel besagen!»
Ist die Sache also für uns erledigt? Ich halte dagegen: Im Sterben und Totsein Jesu Christi macht Gott eine Erfahrung, die sehr wohl in Resonanz gehen kann mit unserer Karsamstag-Stimmung. Aber ganz anders, als wir es meist erwarten. Ein göttlicher und allmächtiger Stimmungsaufheller, der uns die trübe Zeit verkürzt, ist es jedenfalls nicht.
Gottes Einsamkeit und Totsein
Man könnte die letzten Tage Jesu als eine tragische Vereinsamungsgeschichte erzählen. Die Menschen, die ihm beim Einzug in Jerusalem noch den roten Jubelteppich ausgerollt haben, wenden sich von ihm ab. Die Jünger verlassen ihn. Als er sich fürchtet, mit dem Vater allein zu beten, fällt sein handverlesenes Gebetsteam im Garten Gethsemane in den kollektiven Schlaf. Selbst Petrus macht einen schmerzhaften Rückzieher, als es brenzlig wird. Und weder die religiöse noch die politische Gerichtbarkeit wollen sich mit einem fairen Prozess die Hände schmutzig machen.
Schier unfassbar wird es, als Gott sich ihm entzieht und er hinabgleitet in die totale Einsamkeit des Todes: «Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?» (Markusevangelium 15,34)
Hans Urs von Balthasar denkt es in seiner Theologie des Karsamstags konsequent zu Ende: «Wie er auf Erden solidarisch war mit den Lebenden, so ist er im Grabe solidarisch mit den Toten.» Und diese Solidarität hat nichts mehr mit lebendiger Kommunikation zu tun, sie ist ein Mit-tot-sein, ein «Mit-Einsam-sein».
Und was soll uns das bringen?
Die – bitte behutsame – Verknüpfung mit unserem pandemischen Karsamstag liegt auf der Hand: Es sind bereits viele gestorben, tragisch, sang- und klanglos. Und auch für uns, die wir leben, stirbt vieles: Lebensweisen, Arbeitsplätze, Projekte, Firmen, Beziehungen… Die soziale Energie scheint eingeschlafen. Und weil es so weh tut, wenn selbst die Hoffnung auf andere Zeiten stirbt, beerdigen wir die vorläufig auch.
Mir stehen beim Schreiben konkrete Menschen vor Augen, die in all dem fürchterlich einsam sind. Was also, bitte schön, bringt mir da ein Karsamstagsgott, der in einem höllischen Lockdown gefangen liegt?
Ich muss es mir förmlich verbieten, jetzt zu antworten mit «… aber Ostern kommt sicher». Denn genau diese vorschnelle Verkürzung der Zwischenzeit funktioniert für viele ja nicht, wenn sie wirklich drinstecken. Und der Christus bei den Toten vermochte das auch nicht mehr zu denken. Was mir bleibt, mag erst mal erbärmlich klingen:
Nur ein Gott, der genauso wie ich, ja eher noch schlimmer einsam und tot ist, kann bei mir sein. Eine paradoxe Anwesenheit des abwesenden Gottes.
Sie führt mich zu einem redlichen Glauben, der zugeben darf: Es gibt Zeiten, in denen Gott abwesend ist, in denen er sich «aus der Welt herausdrängen [lässt] ans Kreuz» (Bonhoeffer). Wir sollten da nichts schönreden. Aber der Herausgedrängte ist zugleich der Gott mit uns in den kleinen und grossen, persönlichen und kollektiven Karsamstagen dieser Welt. Als wolle er dem Menschen «die Absolutheit seiner Einsamkeit streitig» machen (von Balthasar). Ist es das, was mich diese Zeit einfach nur aushalten lässt? Breitet sich diese stillschweigende Solidarität auch unter uns aus als eine der Schwimmhilfen, wenn die nächste Infektionswelle heranrollen sollte?