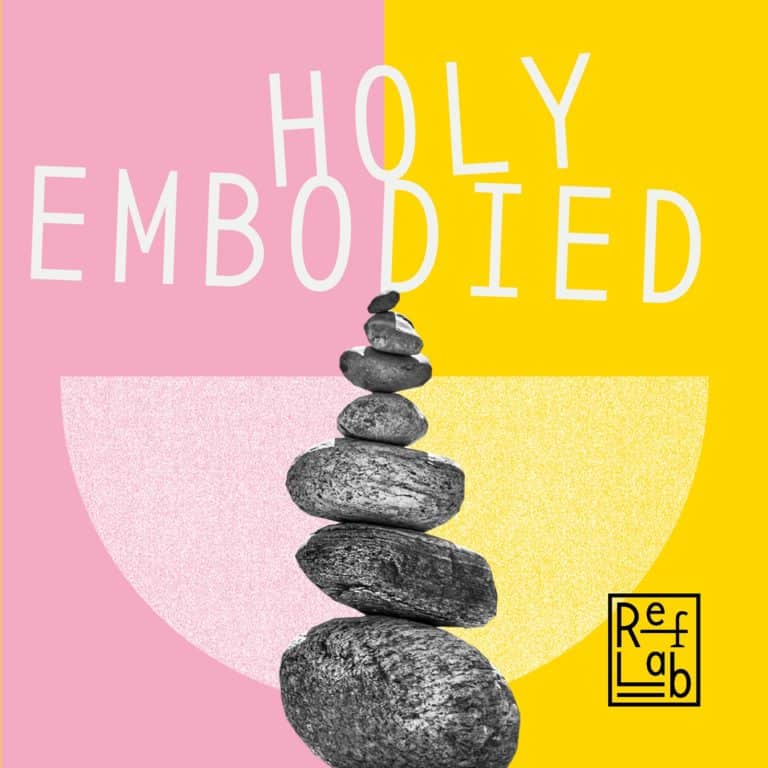Diese Freiheit ist cool. Gleichzeitig ist sie trügerisch. Evelyne hat es in einem Vlog treffend beschrieben.
Antriebsvektoren
Ein äusserer Vektor sagt uns: Noch mehr! Es gibt immer noch einen Text, noch einen Vortrag, noch ein Thema, in das man sich hineindenken könnte. Professor:innen sind Möglichkeitsmaschinen. Sie zeigen, in welche tausend Richtungen gedacht werden kann. Wir Student:innen sollen am besten alles mitnehmen. Niemand im Unibetrieb sagt, dass man irgendwann genug getan hat.
Parallel dazu sagt ein innerer Vektor: Hyperproduktivität! Als kulturell individualistisch denkende und kapitalismusgeprägte Wesen, die ihre Ressourcen in Eigenregie verwalten, gilt die Maxime, nie auch nur eine Minute zu verschwenden und aus allem das Optimum herauszuholen. Auch wenn ich keine Person kenne, die das schafft, schwebt über uns Student:innen beispielsweise der illusionäre Selbstanspruch, acht bis zehn Stunden pro Tag dauerkonzentriert lernen zu können.
Keine Pausen!
Mit diesen Vektoren kreieren wir Ansprüche, denen unsere Realität nicht standhält.
Unser schlechtes Gewissen, unsere Schuld-, Scham- und Angstgefühle treiben uns an.
Wir könnten doch, wenn wir nur ernsthafter wollten! Wenn wir uns einfach nur mehr zusammenreissen und disziplinierter arbeiten würden!
Wir versuchen, jede Handlung auf unsere Leistungsfähigkeit auszurichten: Wir essen gesund, damit unser Kopf klar bleibt. Wir machen Sport, damit wir effizienter lernen und zeigen, dass wir mehr können als nur gescheit sein. Wir machen Party, damit wir den Anschluss an unsere Peers, unser künftiges Netzwerk, nicht verlieren. Jede Form von Pause ist dazu da, dass wir besser performen. Auch die Momente, in denen wir netflixend auf der Couch kollabieren. Pause als Selbstzweck, das gibt es nicht.
Schräge Selbstbilder
Dabei halten wir uns die ganze Zeit für Versager:innen, die das knappe Minimum dessen erreichen, was wir sollten. In der Realität zerfleischen wir uns über die 20 Prozent, die nicht ideal laufen.
Auch bei mir war es ein Prozess, bis ich zugeben konnte, dass ich keine klägliche Versagerin war, sondern eine hochfunktionale Perfektionistin, die sich selbst nie genügt.
Dass ich weit über meine Grenzen hinausging für ein Rennen, dessen Ziel ich nicht einmal kannte. Zu einem Preis, den nur ich bezahlen würde.
Ein verworrener Prozess
Man kann den Schalter, diesem Leistungsdruck zu entrinnen, für niemanden umlegen. Ganz abgesehen davon, dass es kein Schalter ist. Es ist eher ein schmerzhaft langsamer und verworrener Prozess, auf den man sich immer und immer wieder einlässt.
Mir hat es am meisten geholfen zu erkennen, dass ich nur langfristig eine gesunde Form von Leistungsfähigkeit zustande bringe, wenn ich bewusste Ineffizienz einplane. Ich sage Ineffizienz, weil es sich in den Augen der eigenen Leistungsansprüche anfühlt, als würde man bewusstes Versagen planen. Aber eigentlich heisst es nichts anderes, als die eigenen physischen und psychischen Grenzen zu achten. Zu akzeptieren, dass man Mensch und keine Maschine ist. Konkret helfen mir die folgenden fünf Ineffizienzen:
1. Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten
Ich habe es aufgegeben, mir einen produktiven Tag vorzunehmen. Ich kann kein Ergebnis erzwingen, kann nicht bewirken, dass die Seiten, die ich heute schreiben muss, so gut werden, wie ich sie gerne hätte. Was ich plane, sind Möglichkeiten und die sich daraus ergebenden Wahrscheinlichkeiten: Bibliotheksbesuche schaffen Möglichkeiten, dass ich Seiten schreibe. Je öfter ich mich in die Bibliothek bewege, umso mehr erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich Seiten zusammenkommen.
2. Niedrige Hürden
Ich habe die Erwartung abgelegt, dass ich an jedem Tag genau dasselbe leisten kann. Es gibt Einhorn-Tage, da sprudle ich nur so vor Eingebungen. An anderen läuft es, weil es viel zu viel zu tun gibt. Dazwischen gibt es die restlichen, gefühlten 90% aller Tage. Ein erheblicher Teil meiner Uniarbeiten entsteht an solchen Tagen durch konstantes, mittelmässig inspiriertes Schreiben. Aber es generiert Inhalt, den ich in Einhorn-Momenten weiterentwickeln kann. An fast allen Tagen trickse ich mich aus, indem ich die Pomodoro-Technik anwende: Ich gebe mir 25 Minuten, um «einfach mal zu beginnen». Nach 25 Minuten, so sage ich mir, kann ich jederzeit aufhören. Diese Hürde ist dermassen niedrig, dass mein Hirn jedes Mal darüber springt – und weitermacht.
3. Kafi, Schoggigipfeli, Bourdieu, oder: Konzentrationskurven
Eine Variante von Punkt 2 ist, dass ich aufgehört habe, in Konzentrationsblöcken zu denken. Ich plane meine Tage nicht mehr so, dass ich nur zufrieden mit mir bin, wenn ich von 08:00 bis 12:00 und von 13:00-18:00 durchlerne. Ich plane mit meinen Konzentrationskurven. Ich weiss zum Beispiel, dass ich am Morgen müde bin und leicht überwältigt von dem, was zu tun ist. Ich leiste mir die Ineffizienz, mir zuerst einen Überblick zu verschaffen, weil ich weiss, dass mein Hirn noch keinen Bourdieu verarbeitet. Oder ich lese und sortiere, was ich am Vortag geschrieben habe. Erst nach der 10:00-Pause mit Kafi und Schoggigipfeli, wenn ich hochkonzentriert arbeiten kann, tackle ich den Religionssoziologen und seine Schlangensätze.
4. Schlechte Tage
Ich akzeptiere und rechne damit, dass es Tage gibt, an denen alles nervt und ich nur schleppend vorankomme. Ich leiste mir, ja zwinge mich zu vermeintlich ineffizienten Pausen. Ich lege zehn Minuten den Kopf auf den Tisch, lasse die Gedanken abschweifen, schreibe digitales Tagebuch, trinke ein Glas Wasser oder gehe spazieren. Es gibt nur eine Regel: Soziale Medien zählen nicht. Anschliessend probiere ich es nochmals mit «nur 25 Minuten».
5. So richtig unangenehme Pflotschtage
Egal, wie sehr wir uns austricksen, ob wir uns einen richtig guten Kaffee oder eine lange Mittagspause mit Sonnenschein und Pilates gönnen: An manchen Tagen hilft alles nichts. In solchen Moment habe ich gelernt, «aufzugeben» und nach Hause zu gehen. An manchen Tagen reichen ein paar Stunden Pause. Ich habe das Glück, dass ich abends nach 20:00 ein Konzentrationshoch habe und es dann nochmals probieren kann. An anderen Tagen bin ich effektiv unbrauchbar. Kann sein, dass mich gerade etwas so belastet, dass ich den Kopf nicht freikriege, oder dass ich lausig geschlafen habe. Das passiert.
Papierstapel, Couch, Twitter
Für diese Zeit bewahre ich mir meine liebste Ineffizienz-Sache auf: den Papierstapel. Wenn gar nichts mehr geht, geht der Kleinkram. Ich sortiere Termine in der Agenda, aktualisiere die To-Do-Liste, schreibe E-Mails, plane Treffen mit Freund:innen, überblicke das Budget und zahle Rechnungen. Wenn selbst das zuviel ist, räume ich auf, schlafe ich auf der Couch oder versumpfe grinsend auf Twitter. Pause als Selbstzweck, dass es der Seele wieder gut geht.
Kein Greifvogel–Maus–Blick
Je mehr ich mich daran kralle, dass ich doch produktiv sein sollte, umso mehr verkrampfe und blockiere ich mich. Mir hilft es, immer wieder zu sagen: «Du bist kein Greifvogel und deine Arbeit ist keine Maus.» So kontraintuitiv es erscheint, loszulassen, das Gefühl auszuhalten, dass ich innerlich ein bisschen sterbe, weil ich doch noch sooooo viel zu tun habe: Ich tue mir damit den grösseren Gefallen, als wie ein Zombie vor dem Bildschirm zu verharren.
Sehr falsch, ein bisschen falsch, richtiger
Das alles umzusetzen geht nicht von heute auf morgen. Noch heute fällt es mir schwer zu akzeptieren, dass ich physische und psychische Grenzen habe.
Noch heute verurteile ich mich dafür, wenn ich Pause mache, anstatt zu arbeiten.
Ich zweifle, ob ich die Sachen wirklich rechtzeitig fertig bekomme, ob meine Leistung genügt. Pausen zu machen, mit Ineffizienzen, Blockaden und Co zu rechnen, das fühlt sich auch nach den ersten 100 Mal völlig falsch an. Manchmal frage ich mich, ob es nicht doch ein Geheimrezept gibt, das ich noch nicht gefunden habe. Ich versuche mir zu sagen, dass es sich mit jedem Mal ein bisschen weniger falsch und irgendwann immer richtiger anfühlen wird.
Ein Pilates-Vergleich
Im Pilates gibt es das Prinzip von Anspannung und Entspannung. Während der Übungen wird die Tiefenmuskulatur im Rumpf auf spezifische Art und Weise angespannt, dazwischen gelockert und entspannt. Nur so bleibt eine dauerhafte Belastung während 60 Minuten möglich. Anders gesagt: Die Fähigkeit, gute Arbeit machen zu können, ist an die Bedingung gebunden, dass es eine Zeit des Nicht-Arbeitens oder des durchschnittlichen bis schlechten Arbeitens gibt. Sonst gäbe es die Unterscheidung gar nicht erst. Du bist kein Greifvogel und deine Arbeit ist keine Maus.