»Ich kann ja auch mal einen Tag zu dir kommen«, sagte meine Freundin am Telefon, »Aber ich weiss halt nicht, wie du es coronamässig so siehst mit Besuchen.« Der Schnee knirscht unter meinen Füssen, die Sonne strahlt, und neben dem Weg, auf dem ich unterwegs bin, ziehen Langläuflerinnen ihre Runden. Eine wohltuende Abwechslung. Seit Monaten arbeite ich zu Hause, die Decke fällt mir auf den Kopf und langsam fürchte ich, seltsam zu werden. Paranoid, die Risiken zu hoch einzuschätzen, übervorsichtig zu sein. Ich wäge ab. »Vielleicht könnten wir auch eine Schneeschuhtour machen?«
Das letzte Jahr zehrt an der Seele, und langsam merken es auch Menschen, die bisher mit viel Optimismus und Geduld durch die Coronazeit navigierten. Der Shutdown, Kontaktbeschränkungen und Home Office setzen zu. »Es gnüegelet«, schön Schweizerdeutsch, höflicher als »es längt jetzt« (»es reicht!«). »Gnüegele« bedeutet, dass etwas zwar nicht ultraschlimm ist, aber endlich ein Ende nehmen dürfte.
Wir machen Yoga und trinken Gin Tonics
Nun ist es nicht so, dass wir kein Verständnis für die Massnahmen hätten. Uns ist bewusst, dass wir im Home Office in einer privilegierten Situation sind. Und wenn ich »wir« sage, meine ich »ich«, aber ich weiss, dass es in meinem Umfeld einigen so geht.
Wir befinden uns weder in einem nassen Zelt auf Lesbos, noch in den Slums von Brasilien, und wir teilen fleissig auf Social Media Artikel, die die dortigen Zustände anprangern.
Wir, die stille Masse, sind eigentlich geduldige, vernünftige Menschen. Und anständige. Wir rufen nicht die Polizei, wenn die Nachbarn ganz offensichtlich am Samstagabend zu Hause eine Party feiern und die 5-Personen-Regel brechen, fühlen uns aber dennoch verarscht. Für die wenigen Zug- und Busfahrten haben wir uns FFP2-Masken besorgt, um uns zu schützen, weil wir uns nicht dafür halten, »Maskensünder*innen« zurechtzuweisen. Wir wissen, dass ihnen böse Blicke zuzuwerfen uns selber mehr zusetzt als denen. Und unsere seelische Gesundheit liegt uns am Herzen. Wir machen Yoga und trinken Gin Tonics. Wir foutieren uns nicht einfach um die Massnahmen, sondern wollen annehmen, was nicht zu ändern ist, und diese Zeit seelisch möglichst unbeschadet überstehen.
F* dich, Corona
Doch langsam merken wir, dass auch wir dünnhäutiger werden. Wenn uns Leute dieser Tage Videos vom Thiel schicken, der Maskenträger*innen als Opportunist*innen beschimpft, oder vom Rima, der den Bundesrat kritisiert, haben wir weniger Kraft zur Debatte als auch schon. Wir halten uns ja nicht an die Massnahmen, weil es der Bundesrat so verordnet, sondern weil uns die Appelle der Wissenschafter*innen einleuchten. Auch wir wollen, dass Corona so schnell wie möglich wieder vorbei ist.
Es braucht immer mehr Kraft, uns selbst vom Sinn der Massnahmen zu überzeugen. Von Wert der geretteten Menschenleben im Verhältnis zu dein Einschränkungen für die Millionen Gesunden. Es gibt dieses Meme, in dem eine Frau ein Kind aus dem Wasser hebt, während ein zweites Kind im Vordergrund mit dem Ertrinken kämpft. Wir halten uns abwechslungsweise für das privilegierte Kind am Beckenrand und für das unbeachtete, nach Luft schnappende.
Gegen aussen geben wir die Hoffnungsvollen, Optimistischen, aber im Stillen fluchen auch wir, »F* dich, Corona«.
Depressionen nehmen zu, ist immer häufiger in den Medien zu lesen. »Corona-Depressionen« heisst das in den Überschriften. Und es dämmert uns, dass auch wir Optimist*innen, Demokrat*innen, wir Vernünftigen nicht immun dagegen sind.
Und was, wenn alles nichts gebracht hat?
Es traf einen Nerv, als ich vergangene Woche über einen Bibeltext stolperte, in dem es um Ausdauer ging, um Geduld, und darum, dass diese reich belohnt wird. »Aus Glauben leben«, stand da, und ich merkte, wie viel Glauben die aktuelle Situation erfordert. Glauben daran, dass es wieder besser wird. Dass die Impfungen nützen und uns wieder Freiheit geben. Dass der Sommer wieder unbeschwerter wird, normaler, man bald wieder Freund*innen umarmen und Gartenpartys feiern darf.
Der Bibeltext sprach zu den frühen Christ*innen, die wegen ihres Glaubens verfolgt wurden und sehnlichst darauf warteten, dass Jesus wieder auf die Erde kommt und sie ein- für allemal erlöst. 2000 Jahre danach ist dies immer noch nicht geschehen. Aber Corona ist anders. Hier rechnen wir nicht in Tausenden von Jahren, sondern in Wochen und Monaten. – Wirklich? Leise Zweifel, ja, Verzweiflung schleicht sich ein. Was, wenn daraus Jahre werden? Jahre der »kleinen Welt«, in der man nur mit ganz wenigen Menschen nahe und unbeschwert Zeit verbringen kann. Jahre der Sorge um Eltern und Grosseltern. Und wenn sich doch herausstellen sollte, dass das alles nichts gebracht hat? Es braucht schon recht viel Glauben, um durchzuhalten.
Sprachlich liegt das Verb, das Deutsch mit »glauben« übersetzt wird, im Bibeltext näher an »vertrauen«. Vertrauen richtet sich an jemanden. Wir, wir vertrauen den Wissenschafter*innen. Wir vertrauen uns selber, dass wir es packen. Aber manchmal merken wir auch, dass wir einbrechen.
Es ist OK
Das ist in Ordnung. Wir müssen nicht immer stark sein. Und wenn ich »wir« sage, meine ich »ich«. Ich muss nicht immer stark sein. Ich gebe mir hiermit die Erlaubnis, auch die Zweifel zu äussern. Mich einsam zu fühlen. Zu weinen, weil ich meinen Freundeskreis vermisse, unbeschwerte Spieleabende, Gespräche in lauten Bars, mit den Gesichtern nahe beisammen. Es ist OK, Angst zu haben, dass die Vorsicht mich seltsam macht und auffrisst.
Es ist OK, in einem Zoom-Feierabendbier oder einem Spaziergang mit Take-Out-Kafi auf die Frage, wie es mir geht, mit »Nicht gut, ich kann langsam nicht mehr« zu antworten. Anstatt mit gequältem Lächeln zu sagen: »Geht schon, ich darf mich ja nicht beschweren.«
Was uns mit den frühen Christ*innen, die auf die Rückkehr von Jesus warteten, verbindet, ist, dass wir nicht alleine sind. In dem Bibeltext heisst es neben dem »Ausharren« auch, dass wir einander »mit Zuspruch beistehen« sollen. Freund*innen halten es aus, wenn man verzweifelt. Sie hören zu, wenn man Zweifel äussert und Unmut darüber, die eigenen Eltern nicht mehr mit unbeschwertem Herzen besuchen und umarmen zu können.
Vermutlich liegt gerade hier das Gegenmittel gegen die Angst, paranoid zu werden. Optimismus und Glaube entstehen nicht in dürrem Erdboden. Sie müssen gegossen und von Liebe gewärmt werden. Und manchmal reicht die eigene Liebe dazu eben nicht mehr aus.
Photo by Maksym Kaharlytskyi on Unsplash



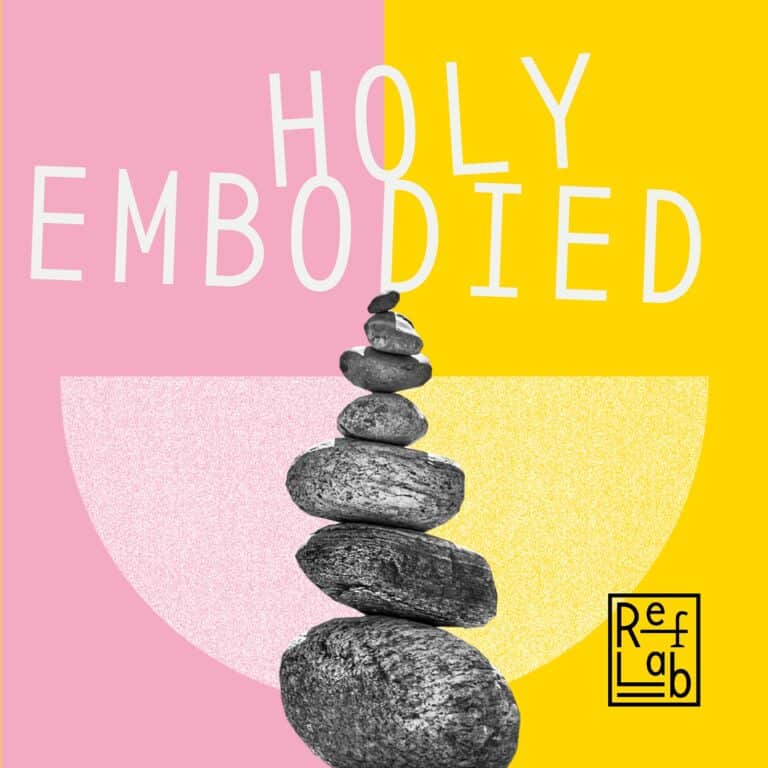




6 Kommentare zu „»Es gnüegelet, verdammt nochmal«“
Genau so fühlt es sich gerade an!
Ich fühle mcih sehr verstanden und mit Worten umarmt. Danke dafür!
Danke, was für ein schöner Kommentar, damit umarmst du mich gleich zurück 🙂 Liebe Grüsse! Und viel Geduld dir, und viele freudige kleine Momente im Alltag.
Auch von mir eine Umarmung! Ich hab oft das Gefühl, dass ich mich nicht traurig/verzweifelt/alleine fühlen darf, weil es mir ja doch eigentlich gut geht. Aber ich glaube genau das ist das Problem. Ich darf es genauso, wie jede und jeder andere auch. Die Zeit gerade zehrt an unser aller Nerven und wir sollten uns erlauben, uns auch mal nicht gut zu fühlen. Alles liebe für dich!
Liebe Josefine, danke für deinen lieben Kommentar und die Umarmung <3 Du hast so recht! Habe mich grad an einen Satz aus Glennon Doyles "Untamed" erinnert: "Feelings are for feeling!"
Ich wünsche auch dir viel Geduld und Menschen, die im richtigen Moment auf irgend eine Weise da sind für dich. Alles Liebe!
Ja die Entzündungswerte unserer Seelen liegen höher als auch schon.
Ginge es ums CRP im Blut würde man schon lange ein Medikament einsetzen. Antibiotika vielleicht.
Du schreibts hier vom Vertrauen.
Genau das ist es.
Weiter so.
Ehrlich, auch zweifelnd, denn der Zweifel ist der Bruder des Vertrauens.
Weiter so.
Danke!