Jubiläen zum Gedenktag
Zum diesjährigen «Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen» feiere ich mehrere Jubiläen: Seit einem Jahr habe ich die klinische und seit einem Monat die genetische Diagnose Hypermobiles Ehlers-Danlos Syndrom (hEDS). Mit dieser doppelten Diagnose ist meine Krankheit offiziell bestätigt – für mich ein Grund zum Feiern.
Bis zur Diagnose EDS dauert es durchschnittlich 14 Jahre. So war es auch bei mir. Obwohl mich, seit ich klein bin, das diffuse Gefühl begleitete: «Da stimmt was nicht mit mir.» Erst jetzt habe ich eine offizielle Erklärung für all die Unstimmigkeiten in meinem Körper und meiner Psyche bekommen.
Bis zur offiziellen Diagnose mussten andere Erklärungen herhalten: Zum Beispiel, dass ich bestimmt hochsensibel wäre, eine dramatische Persönlichkeit hätte, ängstlich sei oder somatoforme Störungen habe – nur, dass ich wirklich krank wäre, darauf kam über 34 Jahre lang niemand, auch nicht ich. Umso entlastender die Gewissheit, dass ich einfach einen Gendeffekt habe.
Der lange und steinige Weg zur Diagnose
Heute weiss ich, dass es für alle Betroffenen von seltenen Erkrankungen durchschnittlich fünf Jahre dauert, bis sie eine Diagnose erhalten. 70 Prozent warten nach medizinischen Auffälligkeiten sogar über ein Jahr auf eine Diagnosebestätigung. 44 Prozent mussten bis zur Diagnosestellung mehr als vier medizinische Fachleute konsultieren.
Die emotionale Belastung, die so ein langer Diagnoseprozess mit sich bringt, ist für einen gesunden Menschen kaum nachvollziehbar. «Medical Gaslighting» nennt man das Phänomen, wenn Symptome von medizinischen Fachpersonen nicht ernst genommen, bagatellisiert, heruntergespielt oder sogar als psychosomatisch abgetan werden.
Besonders Menschen mit seltenen und unsichtbaren Krankheiten werden dadurch vor die Herausforderung gestellt, für die Wahrnehmung und Ernsthaftigkeit ihrer Symptome kämpfen zu müssen.
Viele, auch ich, erleiden dadurch zusätzlich psychische Erkrankungen wie zum Beispiel Anpassungsstörungen, posttraumatische Belastungsstörungen, Angststörungen etc.
Geschlechterungleiche Medizin
Insbesondere für Frauen ist der Prozess der Diagnosestellung komplex und langwierig. So bestätigt der Bericht der Alliance Maladies Rare, dass Frauen* verzögert an Fachärzt:innen oder Krankenhäuser überwiesen werden und das Männer nach wie vor als «der medizinische Prototyp» gelten.
Die Organisation EURORDIS (Rare Disease Europe) kam nach einer europaweiten Erhebung zum Ergebnis, dass die Geschlechterungleichheit in der Medizin unter anderem auch dazu führt, dass es durch die verzögerte Diagnosestellung und die daraus resultierend verspätete Behandlung und Pflege zu schnellerem Fortschreiten der Krankheit und Verminderung der Lebensqualität führt.
Starke Belastung und Kontrollverlust
Generell sind unsichtbare und seltene Erkrankungen (bei dieser Bezeichnung sind in meinem Beitrag immer Behinderungen mitgemeint) eine starke Belastung für die Betroffenen, egal welchen Geschlechts. Obwohl ich schon so lange ahnte, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, sind die Diagnosen und meine neue Rolle als chronisch kranker Mensch nur schwer in mein bisheriges Selbstbild zu integrieren.
Krank sein bedeutet auch Kontrollverlust. Ich fühlte mich in den letzten Monaten oft gestresst, sehr hilflos und ausgeliefert. Stress und Ohnmacht können, das habe ich in der Schmerztherapie gelernt, wiederum den Krankheitsverlauf negativ beeinflussen.
Ich spüre Unsicherheit bezüglich meiner Zukunft, meiner Identität und meiner Lebensplanung. Es braucht eine immense Anpassungsleistung, mit den neuen Erkenntnissen über mich und den daraus resultierenden Umständen umzugehen. Ich kann nur ahnen, wie es anderen Betroffenen geht.
Jetzt erst erkenne ich, wie meine Erkrankungen zu wahrgenommenen und tatsächlichen Einschränkungen führen, die teilweise fast herausfordernder sind als die körperlichen Symptome. Schmerzen kann ich meistens relativ gut wegstecken. Dass ich oft auf Dinge verzichten oder alles abwägen muss, weil es oft einfach nicht anders geht, fällt mir jedoch äusserst schwer.
Belastung und Unterstützung
Es gibt Tage, an denen ich drei, vier Therapien habe oder weit fahren muss, um eine Spezialistin zu sehen. Krank sein ist zeitaufwändig. Auch der Umgang mit dem Gesundheitssystem, mit medizinischen Fachpersonen und Behörden ist nicht einfach. Es bedeutet oft, erneut angezweifelt zu werden, erneut die teils schmerzhaften Tests durchzuführen, sich erneut in eine vulnerable Position zu begeben und nie recht zu wissen, ob das Gegenüber einem glaubt oder was am Ende im Bericht steht.
Diese Belastungen führen auch zu familiären, sozialen und finanziellen Problemen – umso mehr, wenn es sich um eine unsichtbare und seltene Krankheit handelt. Unterstützung erhält man, ausser man hat ein gutes soziales Umfeld, kaum. Kranke Menschen sind oft auch einsam.
Erwartungshaltungen
Unsere Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, dass Menschen leistungsfähig sind. Mir begegnet oft die Erwartungshaltung, dass auch erkrankte Menschen schnellstmöglich wieder die erforderten Leistungen erbringen können.
Dabei muss es nicht einmal um aussergewöhnlichen Einsatz gehen. Es reicht, dass die Grossmutter erwartet, dass man wie früher mit der gesamten Familie Weihnachten feiert, auch wenn das in einer akuten Schmerzphase sehr anstrengend ist oder man durch Medikamente unter starken Nebenwirkungen leidet und lieber im kleinsten Rahmen feiern würde.
Es reicht, dass der Arbeitgeber erwartet, dass man an seinem freien Tag an der Weihnachtsfeier teilnimmt, obwohl dieser Tag normalerweise für die Erholung reserviert ist.
Diese, teils auch unausgesprochenen Erwartungshaltungen führen zu grossen Unsicherheiten und Gefühlen der Unzulänglichkeit und auch zu Scham.
Meine soziale Rolle ist viel unklarer geworden, seit ich weiss, dass ich krank bin, nicht nur für mich, sondern auch für mein Umfeld. Ich fühle mich unwohl, Dinge abzusagen, weil ich niemanden enttäuschen will. Ich geniere mich, immer wieder darauf hinzuweisen, dass ich nicht so schnell bin, nicht so gut Zug fahren kann, nicht so belastbar bin.
Das Jahr der Behinderungen
Am Gedenktag «Internationaler Tag der Menschen mit Behinderungen» feiere ich also mein Jubiläum als offiziell diagnostizierter Mensch mit einer seltenen, unsichtbaren Krankheit und bin dankbar, dass ich mich hier und an anderen Orten zur Situation von uns Betroffenen äussern darf.
Ich fordere aber auch eine noch stärkere Auseinandersetzung mit unseren Problemen und den Barrieren, denen wir täglich begegnen.
Ich fordere mehr Sichtbarkeit auch für die Menschen, die stärker betroffen sind, weniger wortgewandt oder normativ sind als ich. Und ich erwarte Gespräche und das Entwickeln von Lösungen gemeinsam mit uns Betroffenen – politisch, gesellschaftlich und auch kirchlich.
Meine Wünsche für 2024
Letztes Jahr um diese Zeit schrieb ich den ersten Artikel auf RefLab zum Tag der Behinderung. Ich schrieb, dass ich mir wünsche, dass wir und insbesondere Christmenschen ein ganzheitlicheres Verständnis dafür entwickeln könnten, wie Menschen mit und ohne Behinderung gleichwertig integraler Bestandteil der Gemeinschaft werden können.
Ich wünschte mir auch eine vertieftere Auseinandersetzung mit exkludierenden Strukturen und Denkweisen. Das war in diesem Jahr auf RefLab und an anderen Orten möglich – ich und auch andere Betroffene wurden gehört; zum Beispiel an der Behindertensession am 24. März 2023.
Und auch dieses Jahr möchte ich Wünsche äussern, heute richte ich sie jedoch direkt an mich und an alle anderen Betroffenen – natürlich können auch zwischenzeitlich gesunde Menschen diese Wünsche für sich beanspruchen:
- Ich wünsche uns Akzeptanz für unsere Versehrtheit und unsere mentalen und körperlichen Zustände. Ich wünsche uns liebevolle Begegnungen mit uns und unseren Mitmenschen. Ich wünsche uns Geduld und Vertrauen in unsere Körper und Psychen und ich wünsche uns Pausen, viele grosse und kleine Pausen inmitten des Krankseins.
- Ich wünsche uns Ausdauer und dass wir schneller zu Diagnosen kommen. Ich wünsche uns ein solides Gesundheitssystem und die Möglichkeit, unsere Leistung so zu bringen, dass sie uns nicht auslaugt, sondern zum Erblühen bringt, privat und beruflich.
- Ich wünsche uns den Mut, für uns einzustehen. Ich wünsche uns, dass wir unsere Rollen neu ausfüllen lernen, so, wie es für uns stimmt und uns und unserem Umfeld Segen bringt. Ich wünsche uns Selbstfürsorge, Achtsamkeit, Selbstbewusstsein.
- Ich wünsche uns heilende Gottesbegegnungen, schnell erkennende und empathische Ärzte, weise Gutachterinnen und Beziehungen, in denen nicht nur wir getragen werden, sondern in denen auch wir tragen dürfen, denn wir sind auch stark.
- Ich wünsche uns Frieden. Ich wünsche uns Akzeptanz. Ich wünsche uns Glück.
Ehlers-Danlos Syndrome
Bei den Ehlers-Danlos Syndromen handelt es sich um einen seltenen Gendefekt im Bindegewebe mit vielen Begleiterkrankungen. Die wichtigsten sichtbaren Erkennungsmerkmale sind eine Überdehnbarkeit der Haut und überbewegliche Gelenke, Gefässe, Bänder, Muskeln, Sehnen und Organe. EDS-Betroffene leiden unter starker Instabilität des Bewegungsapparates und dadurch unter starken chronischen Schmerzen und Erschöpfung.
Chronische Erkrankungen
Auch chronische Erkrankungen können als Behinderung anerkannt werden. Das Sozialrecht spricht von Menschen mit Behinderungen, wenn die körperliche, seelische oder geistige Verfassung eines Menschen von dem für das jeweilige Lebensalter typischen Zustand abweicht und die Person in Wechselwirkung mit bestehenden Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft über einen längeren Zeitraum gehindert wird.
Foto von Krišjānis Kazaks auf Unsplash


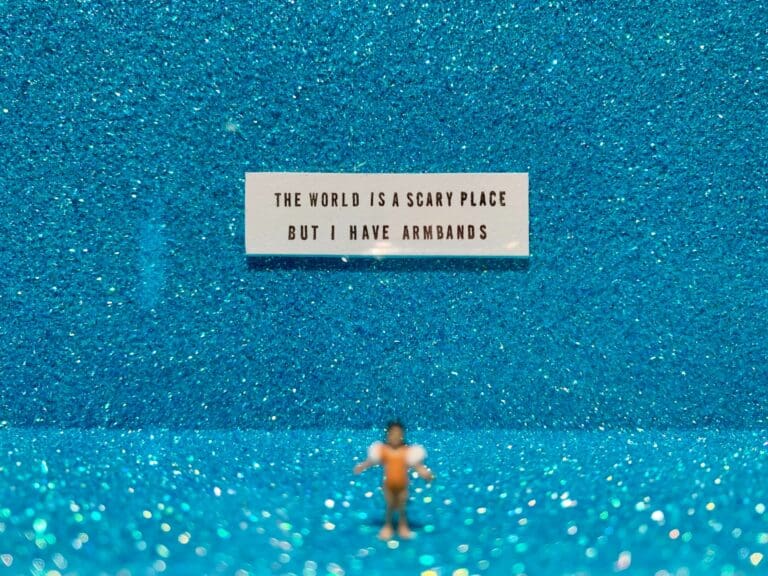
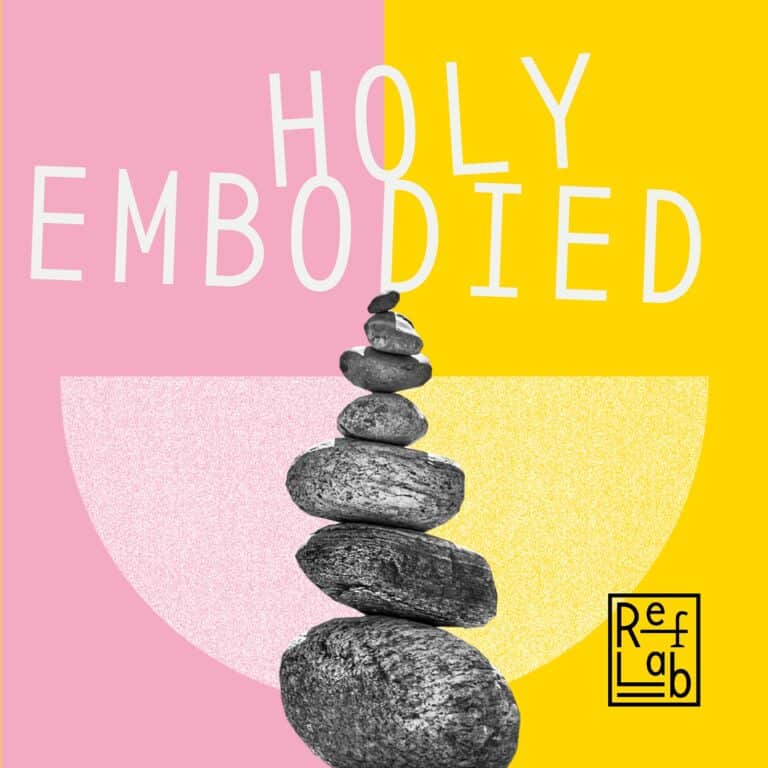




3 Kommentare zu „Ein Jahr krank“
Bewertungsoption funktioniert nicht → „Karma-Boost“ halt so.
Danke fürs Sichtbarmachen von (h)EDS :-)!
Ich bin sehr berührt vom Text, auch weil er so verfasst ist, dass man sich hineinfühlen kann. Gerade den Leistungsdruck kennt vermutlich jede Person, auch jene ohne eine chronische Krankheit (gerade den „subtilen“ Druck wie es in diesem Text durch die Grossmutter resp. den Arbeitgeber dargestellt wird). Aber auch, dass man nicht wahrgenommen oder ernstgenommen wird, ist sicher für viele nichts Fremdes. Umso mehr kann es für alle Menschen hilfreich sein, wenn auch wirklich alle inkludiert in der Gesellschaft werden.
Mein Sohn hat 5 Jahre auf seine Diagnose hEDS warten müssen und all das erlebt, was du beschreibst. Er war 11 Jahre alt und sein Leben wie er es bis dahin kannte, war für immer vorbei. Jetzt sind es 12 Jahre, dass er krank ist und am Leben nicht teilnehmen kann. Aber seit letztem Jahr stimmt endlich die Diagnose, denn die war nach der Hautbiopsie noch klassisches EDS. Deshalb glaubte ihm niemand die Schmerzen.
Wie sehr wünschte ich mir, dass alle Menschen meinem Kind vertraut und geglaubt und Mitgefühl bewiesen hätten. Aber da war keiner. Nicht die Lehrer, nicht die Ärzte, die Verwandten, nicht die Freunde. Ja nicht einmal der Vater und der Bruder. Da macht das Leben keinen Sinn mehr. Bis man, Gott sei Dank!, den Sinn des Lebens in IHM gefunden hat. Und das trägt jetzt mein Kind.