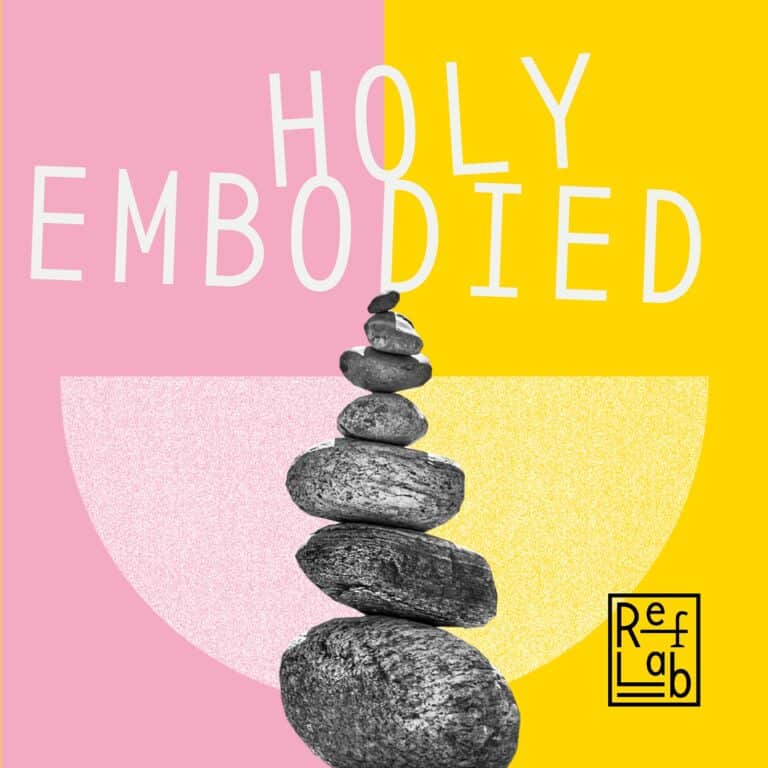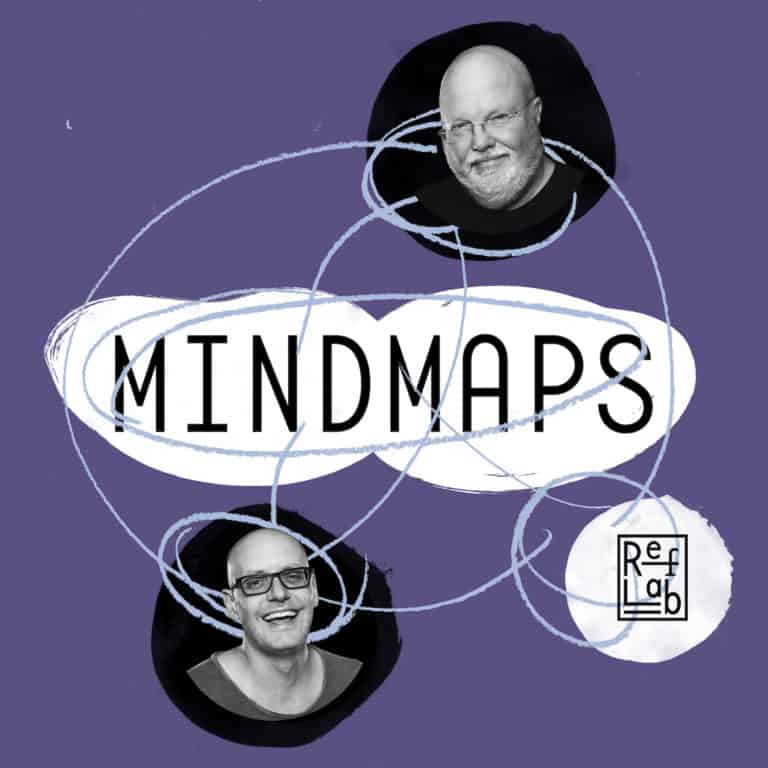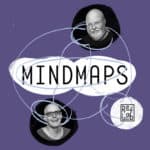Ich gehöre zum kleinen Teil der Schweizer Bevölkerung, die Twitter aktiv nutzen. 12 % der über 15-Jährigen sind es ungefähr. Die meisten Menschen können mit dieser Plattform nicht viel anfangen. Zuviel Text, und dann doch nur so kurz, zu wenig Bilder, zu nerdy, und wie findet man überhaupt heraus, wem man folgen soll?
Für mich ist Twitter extrem wichtig geworden. Mein berufliches und akademisches Netzwerk wäre ärmer ohne diese Plattform. Ich würde vermutlich nicht im RefLab arbeiten. Und sogar einige Freundschaften habe ich dank eines ersten Kontakts dort geschlossen.
Dieser Artikel ist trotzdem keine Liebeserklärung an Twitter.
Denn eigentlich geht es nicht um die Plattform als solche, sondern um die Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Darum, wie zum «echten Leben» sowohl online als auch offline gehören. Wie eine Online-Community sowohl die digitale als auch analoge Welt umfassen kann – in guten wie in schlechten Zeiten, wie mir kürzlich aus traurigem Anlass neu bewusst wurde. Doch dazu später.
Online und offline sind nicht zu trennen
Kürzlich habe ich festgestellt, dass einer meiner Twitter- und Instagram-Bekannten, der auch zur RefLab-Community gehört, im gleichen Quartier lebt. Eines Sonntagnachmittags trafen wir uns spontan zum Kaffee im kleinen Park zwischen unseren Häusern. Es ergab sich ein Gespräch, das den Umfang von Tweets und Insta-Nachrichten gesprengt hätte. Seither gehen wir manchmal spontan spazieren und stellen hin und wieder ein Glas selbstgemachte Chili-Sauce oder ein Sonntagszöpfli in den Briefkasten des anderen.
Ich habe via Twitter schon einige Bücher und Studientipps erhalten, spontan einen Coworking-Platz für ein paar Stunden bekommen, und jemand aus meiner Community fand vor einer Tagung einen Übernachtungsplatz auf unserem WG-Sofa.
Einige sind via Twitter zur «Hiking Church» gestossen, die ich mitgegründet habe. Ich habe in schwierigen Momenten spontan um Gebet gefragt, daraufhin Dutzende von 💜 und 🙏 erhalten und mich getragen gefühlt. Seit meinem Umzug in eine neue Stadt sind hier mehrere Freundschaften entstanden zu Leuten, die ich vorher nur online kannte.
Twitter gehört für mich genauso zum realen Leben wie etwa das RefLab-Büro.
Das Gefühl, sich zu kennen
Übrigens ist es etwas völlig anderes als Online-Dating (ja, natürlich habe ich als Teil der Generation Y auch hier Erfahrungen): Dort sollte man die andere Person ja bei Interesse so schnell wie möglich unverbindlich und an einem sicheren, öffentlichen Ort, aber live treffen, um nicht Gefühle zu entwickeln, die in der analogen Welt Null Grundlage haben.
Beim Online-Netzwerken ist es umgekehrt.
Man «läuft» sich immer wieder «über den Weg», kommt sich irgendwann bekannt vor, diskutiert in den gleichen Threads oder kommentiert gegenseitig Instagram-Stories.
Auf dieser gemeinsamen Filter-Bubble-Basis von Themen, Ansichten und Kommunikationsstil hat man mit der Zeit das Gefühl, sich zu kennen. Und manchmal trifft man sich dann tatsächlich auch offline. Bei der Übergabe eines Buches zum Beispiel, an einer Tagung, oder wenn man feststellt, dass jemand im gleichen Quartier lebt. Kürzlich wurde ich auf der Strasse auf meine Videos angesprochen, von jemandem, der mir auf Instagram folgt.
So wächst das Netzwerk von online zu offline. Und wenn ich die Person vorher online kannte, ist es mir bei einer solchen Begegnung noch nie so vorgekommen, als sässe da jemand völlig anderes vor mir.
Natürlich kommt auch das Gegenteil vor: Dass man im Laufe der Zeit merkt, wer einem definitiv nicht sympathisch ist. Dass jemand in diesem digitalen Dorf eine Nervensäge ist, unhöflich oder aufdringlich. Dann geht man einander halt aus dem Weg.
Der Schock, wenn in der Timeline plötzlich jemand fehlt
Ich hatte diesen Artikel eigentlich schon mal fast fertig geschrieben. Doch dann passierte etwas, das meiner Überzeugung, dass man Menschen auch online persönlich kennenlernen kann, den Boden entriss.
Es war die Nachricht, dass sich jemand aus der Schweizer Twitter-Bubble das Leben genommen hatte. Ein Schock ging durch die Community. Für viele war er wie ein Arbeitskollege gewesen, den man täglich sieht, mit dem man sich hin und wieder an der Kaffeemaschine über das letzte Wochenende unterhält und in der Mittagspause das Weltgeschehen diskutiert. Und hin und wieder ein paar persönlichere Worte per Direktnachricht.
Niemand hatte etwas geahnt. Nach dem ersten Entsetzen darüber gelangte ich zur Erkenntnis, dass dies auch in analogen Beziehungen so sein kann. Dass man immer – und zwar auch offline – niemals den gesamten Menschen kennt. Und besser einmal mehr als zu wenig sagt, dass man jemanden wertschätzt.
Nun trauern wir als Community gemeinsam. Digital und analog, aber auf beiden Ebenen real.
Wir schreiben Tweets mit dem entsprechenden Hashtag, aber auch handschriftliche Einträge in Kondolenzbüchern. In den fünf Lokalen der Schweiz, in denen diese aktuell zugänglich sind, ergeben sich teilweise neue offline-Treffen zwischen online-Bekannten. Man führt aktuelle Twitterdiskussionen bei einem Bier fort, eine auditive Stimme kommt zur sprachlichen hinzu und man hat statt eines Avatars oder Porträtfotos ein Gesicht inklusive Mimik vor sich. Und später «sieht» man sich wieder online.
Doch der Schmerz, dass jemand in der Timeline fehlt, wird bei vielen noch lange bleiben, auch wenn die wenigsten aus der Community diese Person offline kennengelernt haben.
Keine Konkurrenz zwischen digital und analog
Oft werden die beiden Realitäten immer noch als Konkurrenz gesehen: Es gibt «die Social Media» und «das reale Leben». Und ja, das Internet ist für sich genommen nicht das reale Leben. Aber es gehört für viele heute zum realen Leben. Spätestens seit Corona und den Möglichkeiten, welche die digitale Welt im Gegensatz zur analogen in Shutdown-Zeiten bot, wird diese nicht mehr als blosses Luftschloss abgetan.
So wächst langsam das Verständnis dafür, dass es auch innerhalb einer Online-Community Vertrauen, Hilfsbereitschaft und Offenheit gibt. Dass sich die beiden Welten überlappen und nicht mehr voneinander zu trennen sind. Und so würde ich empfehlen, den Aufenthalt in diesem digitalen Dorf umso bewusster zu gestalten.
Im digitalen Dorf schnuppern
Meine besten Tipps dazu:
- Plattform: Eine wählen, die einem liegt. Twitter und seine Communities sind entweder thematisch oder regional orientiert, LinkedIn dient dem beruflichen Netzwerk, Instagram macht am meisten Spass, sollte aber mit bewusstem Fokus genutzt werden, um nicht blosse Zeitverschwendung zu sein. Jede Plattform hat ihre Sprache und Konventionen, in die man sich etwas reinleben sollte.
- Aktiv einbringen: Welche Themen diskutierst du auch offline gerne? Wer gehört zu deinem Netzwerk, wer noch nicht? Indem man Personen folgt, Gruppen beitritt (Facebook, LinkedIn), nach Hashtags sucht, findet man aktuelle Diskussionen aus dem eigenen Interessenbereich. Indem man sich dort aktiv einbringt, auf dem eigenen Profil relevante Artikel teilt und Gedanken anstösst, wird man für andere greifbar und erweitert sein Netzwerk.
- Privatsphäre: Überleg dir gut, welche Bereiche deines Lebens du öffentlich thematisierst. Was ist deine Expertise? Welche Themen interessieren dich? Und was könnten dir schlecht gesinnte Personen ausnutzen? Egal, was du teilst, und wie klein dieser Anteil an deinem Leben auch sein mag, er sollte authentisch sein. Wie ein Puzzleteil, das sich beim besseren Kennenlernen gut mit dem Rest zusammenfügt. Apropos Privatsphäre: Je nach Plattform lassen sich mehr oder weniger Einstellungen vornehmen, um auch für Werbetreibende weniger durchsichtig zu sein.
- Abgrenzen: Nicht alles muss man sich antun, nicht jeden Kommentar beantworten, nicht jede Freundschaftsanfrage annehmen. Man kann in einigen Plattformen Schlüsselwörter oder Personen stummschalten, wenn man nicht gleich die Block-Funktion nutzen will. Grenzen gelten auch beim Zeitaufwand: Wie im Film «The Social Dilemma» gut ersichtlich wurde, tun die Plattformen alles, um einen möglichst oft und lange dort zu haben. Das funktioniert sehr gut – umso hilfreicher kann es sein, sich Zeitlimits zu setzen oder auch immer mal wieder eine Auszeit zu nehmen.