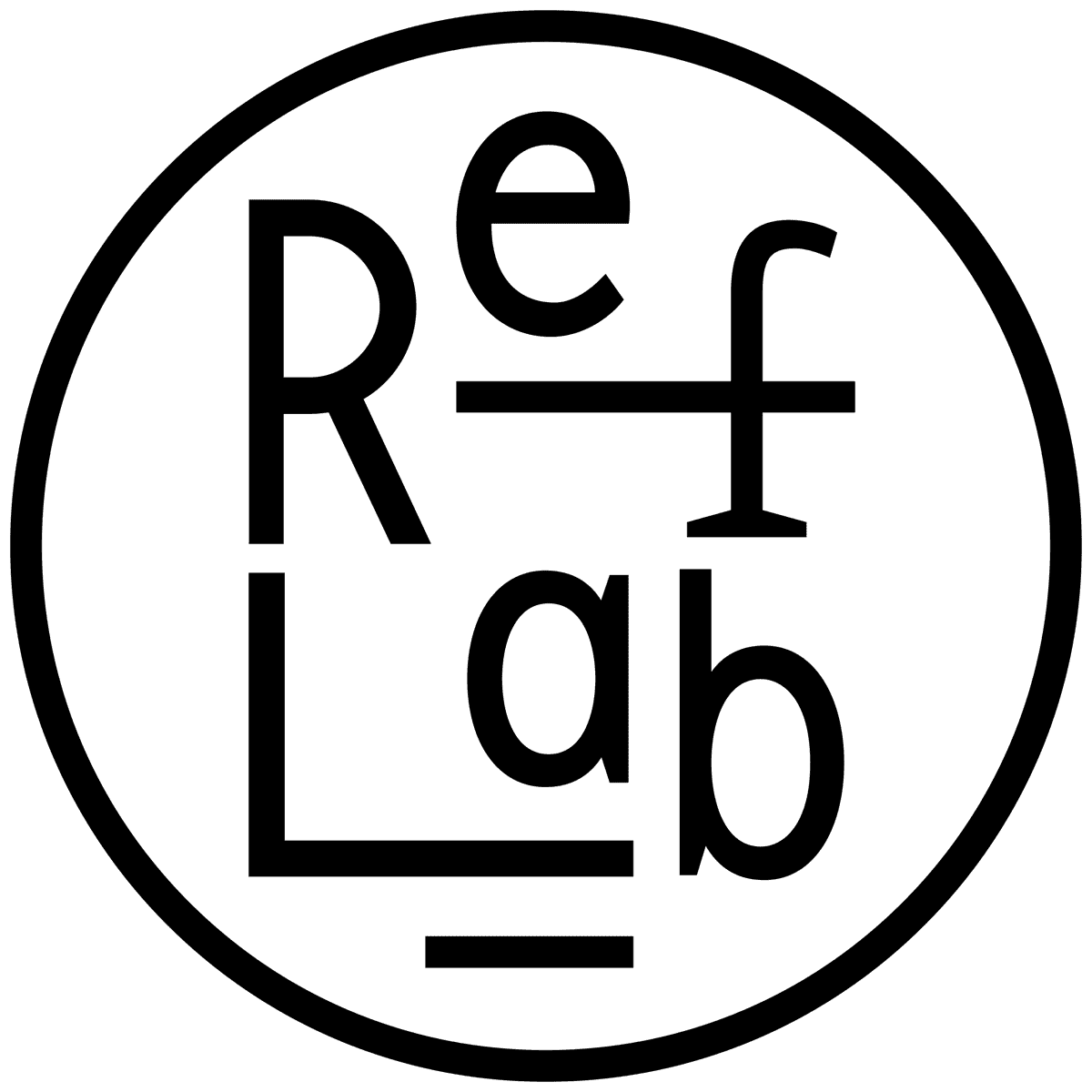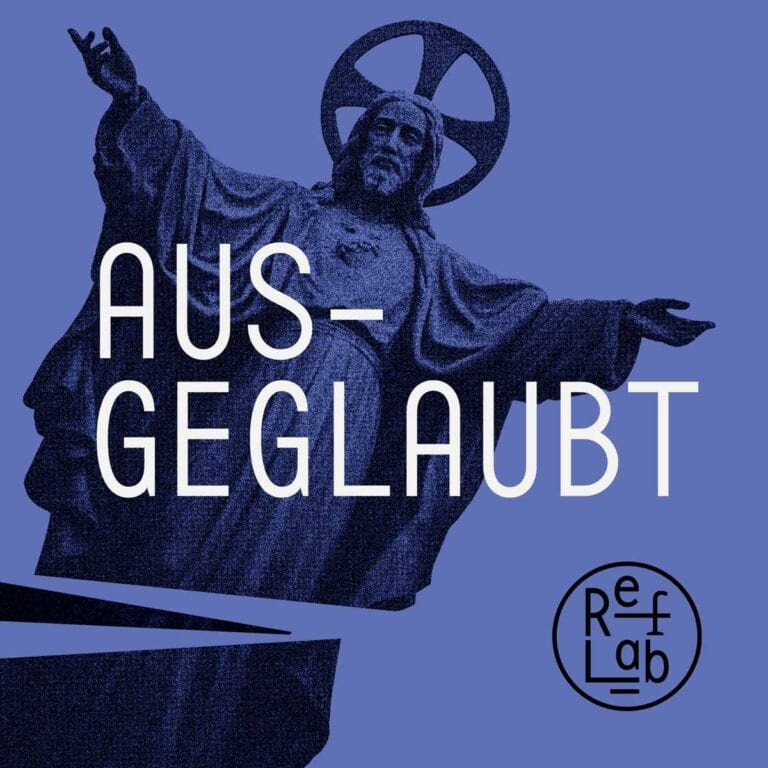Prophetie hat in der Kirchgasse neben dem Grossmünster ein halbes Jahrtausend Geschichte. Zürcher Pfarrer wurden 1525 von Huldrych Zwingli und seinen Kollegen verpflichtet, die reformatorische Auslegung der Bibel zu lernen. Die Geistlichen, klassisch liturgisch ausgebildet, wurden, ob sie wollten oder nicht, mit einer neuen Wirklichkeit konfrontiert.
Nicht mehr päpstlicher Gehorsam, sondern das Studium der Schrift sollte das Maß aller Dinge sein. “Es gilt nit meinen! Die Göttlich Geschrifft harfür”, steht noch heute an den Mauern des altehrwürdigen Gebäudes. Nicht meinen also, sondern humanistische Bildung und kluge Bibelauslegung läuten eine neue Epoche ein.
Neben den 500-Jahr-Feierlichkeiten trifft sich in diesen Räumen Anfang Juli die Crème de la Crème der Forschung rund um Religion und KI und spricht über Hoffnungen, Ängste und die Realität von religiöser KI und Robotik.
Ein neues Zeitalter?
Die Tagung „AI Hopes, Fears, and Realities: An Interdisciplinary Dialogue“ versucht Trends, Entwicklungen und Herausforderungen zu prophezeien und wissenschaftlich zu begleiten. Und eine alte Frage hängt über allen Vorträgen: Haben wir es hier mit einer neuen Epoche zu tun? Müsst es heute heissen:
“Es gilt nit dänken! Die Künstliche Intelligenz harfür”.
Pauline Hope Cheong von der Arizona State University stellt Predigt-Bots vor, die den Pfarrern heute all die Mühe, die Zwingli seinen Kollegen machte, abnehmen. Statt jahrelangem Studieren gibt es Predigten auf Knopfdruck. Das Versprechen: Effizientes Predigen! Keine Zeit mehr für die Vorbereitung opfern! Kein lästiges Bücherwälzen!
Pfarrer:innen in den USA, die sie befragte, reagieren verhalten auf ein Predigttool, das verspricht, ihr jahrelanges Studium überflüssig zu machen. Das überrascht kaum, niemand wird gerne von einem statistischen Modell ersetzt. Auch die viel diskutierte Studie, die sich stark verkürzt so lesen lässt, dass KI-Gebrauch uns dümmer macht, wird in den Raum geworfen:
“Wollen wir denn, dass unsere Pfarrer:innern dümmer werden?!”
Helfe sich, wer kann
Doch so einfach ist es nicht. Im Vertrauen berichten mir Kolleg:innen, dass heute eine beträchtliche Zahl von Pfarrer:innen ChatGPT, Claude etc. das Predigtschreiben überlässt. Eine hochengagierte Kollegin erzählt mir unlängst, dass sie gar Komplimente für ihren einzigartigen Predigtstil bekam, als sie die Kanzelrede aus Zeitgründen vollständig der KI überlassen musste.
Dahinter steckt keinesfalls Dummheit, sondern eine Systemkrise, die auch Cheong beobachtet: Viele Geistliche schreiben nicht nur eine Predigt, sondern einen Blogpost, einen Instapost, eine Podcastandacht und so weiter. Die anwesenden Empiriker:innen beschreiben die Berufsgruppe als überarbeitet, überlastet und überbeansprucht. Kein Wunder also, dass sie nach allen Strohhalmen greifen, die sie kriegen können.
Akademischen Theolog:innen und Mitarbeitenden der “Digitalen Kirche” geht es nicht besser. In Zeiten multimedialer Omnipräsenz ist es nie genug. Der Rest kommuniziert scheinbar immer noch ein bisschen mehr. Der Kampf um die beschränkte Aufmerksamkeit der Menschen verkommt zur ermüdenden Materialschlacht, bei der KI eine unermüdliche Reserve verspricht.
Schreib’ ich, oder schreib’ ich nicht
Es dauert dementsprechend eine Weile, bis ich eine Frage stelle, die mir immer wieder im Kopf herumgeistert:
“Mag irgendwer noch seine Arbeit?”
Einige Menschen, die ich kenne, die in die Wissenschaft gingen oder die einen Verkündigungsdienst antraten, haben große Freude am Bücher- oder Predigtschreiben. Und doch lassen sie sich das abnehmen, was ihnen vorher Freude bereitet hat oder wozu sie sich berufen fühlten: das Schreiben, das Brüten über Texten, das Brainstormen und Ideen kommunizieren.
Und es gibt sie, zeigt Cheongs Untersuchung, die Geistlichen, die zu große Freude haben oder eine derart große Berufung verspüren, dass sie keine Maschine an ihre Texte lassen, aber es ist eben keinesfalls die Mehrheit. Diejenigen, die das Schreiben der KI anvertrauen, beschwören ein Versprechen oder einen Mythos, den ich zugegebenermaßen auch schon öfter vorgebracht habe.
Die finnische Wissenschaftlerin Katja Valaskivi bringt ihn auf den Punkt:
“KI verspricht uns Freiheit von lästigen Aufgaben. Weil wir Wichtigeres zu tun haben. Wir können endlich das machen, wozu es wahre Menschlichkeit braucht.“ Nur um zugleich damit aufzuräumen:
„Aber was ist das? Welche wichtigeren Dinge haben wir zu tun?“
Diese Frage ist berechtigt. Klar, das Versprechen ist, dass Berufsreligiöse endlich Zeit haben für individuelle Seelsorge und diakonische Aufgaben. Aber was ist, wenn die Texte, die wir schreiben, doch irgendwie wichtig sind oder die eine oder andere Predigt heilsam für die ist, die sie hören?
Neue Heilsversprechen
So war es schon bei der flächendeckenden Einführung des Personal Computers (PC). Versprochen wurde, dass wir alle in Freizeit ertrinken würden und gar nicht mehr wüssten, wohin mit der ganzen Zeit, die uns effiziente Daten- und Terminverwaltung bescheren würde. Die Realität ist, wie wir alle wissen, eine andere.
Technologische Innovationen haben den Hang dazu, Freiheit zu versprechen und Abhängigkeiten zu erzeugen.
Heidi C. Campbell von Texas A&M kennt überzogene Erwartungen und Heilsversprechen, weil sie schon die Anfänge des Internets begleitet hat. Ob sie überrascht ist durch die Entwicklung der letzten Jahre? “Nein”, antwortet sie, “eigentlich nicht. Es sind die gleichen Fragen wie vor 30 Jahren.” Nur eines ermüdet sie, wenn es um den kirchlichen Umgang mit KI geht: “Alle wollen immer wissen, ob KI gut oder schlecht ist. Aber Theologie ist die Wissenschaft des Dazwischens.”
Spricht man mit Forscher:innen wie Kristina Eiviler, hört man von einer Euphorie, die nachdenklich macht. Die Anthropologin begleitet in Japan die Arbeit des Lab 22, das religiöse Roboter entwickelt. Sie widerspricht denjenigen, die KI und Religion für eine absurde Spielerei oder einen zeitweiligen Hype halten.
Religion ist für die Menschen gar nicht mehr analog vorstellbar.
Eine Frage von Macht und Verantwortung
Auf mich wirken religiöse Roboter meistens immer noch unfertig, hemdsärmlich, und die Gespräche mit ihren Entwickler:innen lassen mich regelmäßig enttäuscht zurück. Besonders ihr Umgang mit ethischen Herausforderungen bereitet mir nicht selten Bauchschmerzen.
Kristina Eiviler widerspricht mir: Wer religiöse KI und Roboter entwickelt, hat ihrer Erfahrung nach hohe Ansprüche und macht sich viele Gedanken, was diese Technik für Langzeitfolgen haben könnte. Sie erlebt die Szene als um- und weitsichtig.
Ich bin nicht der Einzige, der in diesen Tagen etwas vermisst: Thomas Schlag, Gastgeber und Professor an der Universität Zürich, moniert, dass die Frage nach der Macht kaum interessiert.
Unklar bleibt im Grunde, welche Motivation die Branche hat. Ist es Geld? Persönliche Betroffenheit? Sendungsbewusstsein? Missionarischer Eifer? Neugier? Letzteres würde man zumindest von der Forschung erwarten. Aber auch hier stellt sich die Frage, warum wir ausgerechnet an diesem Thema forschen?
Was machen wir da eigentlich?
Ich selbst habe mir diese Frage oft gestellt. Ich gehöre sicher zu den skeptischen Stimmen im Diskurs, aber auch ich muss mich fragen, ob ich nicht Teil der Hypemaschinerie bin. Ob mein Alibi, dass man die wissenschaftliche Begleitung dieser Entwicklung nicht denen überlassen darf, die sie vorantreiben und die eine Karriere auf dem Rücken einer ausbeuterischen Technologie machen, stichhaltig ist, bin ich mir selbst nicht mehr sicher.
Ich selbst arbeite derzeit nicht mehr an der Universität, die letzten Aufsätze und Vorträge rund um KI sind langsam abgeschlossen. Mittlerweile leite ich in einer alten Autogarage ein Projekt der Reformierten Kirche für jungen Erwachsenen als Seelsorger. Ganz analog möchte man meinen, doch es bewahrheitet sich, was Kristina Eiviler beobachtet: Als Teil der allgemeinen Digitalisierung unserer Religion verfolgt mich KI auch in die praktische Arbeit.
Ob Tagungskonzepte, Illustrationen, Korrekturen und automatische Untertitel auf Instagram – ganz subtil wird es Teil religiöser Praxis, hält Geistlichen das Händchen und macht für sie die lästigen Aufgaben. Ein emsiger digitaler Diener, der sich für nichts zu schade ist, nachts und wochenends werkelt und immer parat ist, unsere Arbeit zu erleichtern.
Was die Reformatoren vor 500 Jahren davon gehalten hätten? Eine andere Inschrift im Kreuzgang verkündet:
„Arbeit ist etwas Gutes, etwas Göttliches.“
Wenn das kein Segen ist.
Weiter Beiträge zu dem Themenfeld Digitalisierung und Kirche findest du in unserer entsprechenden Themenwelt.
Der Titel für diesen Text wurde mit KI generiert. Auch das Bild wurde entsprechend erstellt.