So kann sich Gärtnern anfühlen
Es war oft ein Hochgefühl, und ich vermisse es immer mal wieder: Das Waschen der Hände nach getaner Arbeit. Wenn die Bürste zigmal über die Haut schrubbte und unter die Fingernägel griff. Damit sich auch der letzte Rest Erde löste, den ich aus dem grossen Gemüse- und Blumenfeld an mir hatte. Wie gut roch die grüne Beschichtung, die sich beim Schneiden der Tomatenpflanzen um meine Fingerkuppen gepappt hatte. Wie bestätigend war es, wenn mir die Dusche all die Belegexemplare dessen rausspülte, was ich den ganzen Tag gemäht und geschnitten hatte.
Der Stolz zweier Gartenhände
Vier Jahre habe ich Anfang meiner Zwanziger in einer Gärtnerei gearbeitet und dabei viel gelernt. Auch über mich selbst. Darüber, wie anstrengend aber eben auch befriedigend die Gartenarbeit sein kann.
Wie stolz mich Hände machen, die erst mal nicht ganz sauber werden, weil sie sich in die Erde eingegraben und die Natur intensiv berührt haben.
Zwei Arten von Handpflege
Maniküre in Ehren – Hände, denen man die Selbstpflege ansieht, sind schön.
Aber Hände, denen man die Gartenpflege ansieht, sind von besonderer, geerdeter Schönheit. Und sie spiegeln etwas von den göttlichen Händen des Schöpfers wider. Gärtnern ist göttlich und menschlich.
Im vorangehenden Blog «Raus in den Garten» war davon die Rede, dass wir als Gärtner:innen die Natur nachahmen. Jetzt geht es um so etwas wie eine handgemachte Nachahmung der gärtnernden Gottheit.
Der Garten in Eden war kein Schlaraffenland
Paradiesgeschichten finden sich vermutlich in allen Kulturen und Religionen. Oft sind es Mythen von einer göttlichen Gestalt, die einen idealen Garten schafft, in dem die Menschen perfekte Lebensbedingungen vorfinden. Es gibt nichts an diesem Ort, was die Fülle, Freude Harmonie und Glückseligkeit des Lebens hemmt oder schädigt.
Bei den Griechen und Römern steigert sich die Vorstellung vom Paradiesgarten in Richtung märchenhaft und schlaraffenartig. Im Vergleich dazu ist die biblische Geschichte von einem Garten in Eden mythenkritisch. Weil Gott und Mensch hier arbeiten und schöpferisch tätig sind. Dazu ein paar biblisch-theologische Notizen.
Eden – das gemeinsame Projekt von Gott und Mensch
Die Schöpfungserzählung der Bibel zeichnet einen Gott, der Erdboden in die Hände nimmt und daraus etwas formt.
«Da bildete der HERR, Gott, den Menschen aus Staub vom Erdboden» (1Mo 2,7).
Er pflanzt einen Garten und setzt den Menschen dort ein als Gärtner. Was für die ganze Schöpfung gilt, gilt auch für den Garten in Eden: Er entsteht nicht in einem Moment durch göttlichen Fingerschnipp. Er ist etwas Angefangenes, aber noch nicht Vollendetes.
Gott lässt sich und seinem Garten Zeit für Entwicklung. Und vor allem: Gott will den Menschen bei seinem Eden-Projekt als Co-Gärtner:in dabeihaben.
Drei Arten von Kreativität
Die gärtnernde Gottheit ist mit unterschiedlichen Arten von Kreativität am Werk. Ich war theologisch lange fixiert auf das, was fachsprachlich als «Schöpfung aus Nichts» (creatio ex nihilo) bezeichnet wird. Gott spricht etwas, das nicht vorhanden ist, ins Sein. Bis mir auffiel, dass diese Kreativität direkt übergeht in ein schöpferisches Handeln, bei dem Gott bereits vorhandene Schöpfung einbezieht – etwa bei der Erschaffung des Menschen.
Am intensivsten gestaltet sich die kreative Synergie dort, wo der Schöpfer die Erde ermächtigt, selbst Neues hervorzubringen und wachsen zu lassen (1Mo 1,11 und 2,9).
Anvertraute Gärtner:innenschaft
Und schliesslich vertraut Gott dem Menschen den Garten und die Tiere an, und zwar ernsthaft. Er scheint wie gespannt auf jenen Prozess, in dem der Mensch die Tiere benennt. Was dabei für den Menschen herauskommt, ist die Erkenntnis: Es gibt noch einen anderen Weltzugang als den menschlichen. Und Gott stellt fest: Im Garten fehlt noch was, damit der Mensch ganz Mensch sein kann.
Pure Ermächtigungsmacht
Gott, Mensch und aussermenschliche Geschöpfe arbeiten in den biblischen Schöpfungserzählungen immer enger zusammen. Das Ziel ist es, einen Garten als Mikrokosmos zu erschaffen und zu pflegen, von dessen Lebensbaum in der Mitte ausgehend die ganze Welt bewässert wird, damit noch mehr Gärten entstehen können.
Gott behält seine Kreativität nicht für sich, sondern ermächtigt die Geschöpfe, schöpferisch zu sein. Und gerade darin, kommt seine Schöpferkraft zum Ziel.
Im Garten arbeiten heisst Gott nachahmen
Überall, wo wir tätig sind, kann unsere Gottebenbildlichkeit hervorleuchten. Ich möchte es daher mit dem Gärtnern auch nicht übertreiben. Und doch glaube ich, dass die Gartenarbeit uns besonders günstige Bedingungen bietet, um eine Art des Handelns zu kultivieren, die dem Gärtnertum Gottes ähnlich ist und es ihm nachmacht. Zum Segen für alle Geschöpfe.
Den Garten wachsen lassen
Ein guter Garten lebt davon, dass die Gärtner:innen sich um die bestmöglichen Wachstumsbedingungen bemühen. Doch dann kommt der Moment, ab dem weitere Aktivitäten kontraproduktiv sind. Jetzt heisst es, den Boden, die Saat, die Pflänzchen in Ruhe und allein zu lassen. Alles andere würde das Wachstum unter Umständen zerstören. Dieses gelassene Vertrauen in die Grünkräfte der Natur können wir im Garten lernen, und mein Gärtnermeister musste es auch mir beibringen.
Wir gewähren an dieser Stelle dem Garten das, was uns selbst von Gott geschenkt worden ist:
Ermächtigung. Sie will geübt werden, weil sie von einem feinen Zusammenspiel zwischen Aktivität und Passivität lebt. Von einem Gespür für die Regulierung der eigenen Energien, damit es zur Synergie mit den Kräften kommt, über die wir nicht verfügen können.
Den Garten geniessen und darin spielen
Nach getaner Arbeit zur Ruhe kommen, den Garten geniessen und darin ausspannen oder entdecken, dass sein Sinn auch darin liegt, uns zum Spielen einzuladen. Das ist genauso menschenfreundlich wie kreativ und fürsorglich tätig zu sein. Und es ist genauso göttlich wie menschlich. Am Abend eines jeden Schöpfungstages legt Gott die Arbeit nieder, geht in der Kühle des Gartens spazieren und empfiehlt seinen Menschen, es ihm am Sabbat nachzumachen, nämlich ebenfalls zu ruhen und Atem zu holen.
Im Garten die eigenen Kräfte wiederfinden
Das Schöne am Gärtnern ist, dass wir uns zu einem grossen Teil experimentieren und ausprobieren dürfen. Okay, ich blende jetzt mal diejenigen aus, die sich damit ihren Lebensunterhalt verdienen.
Aber ein Garten verzeiht viel. Anfänger:innen sind herzlich willkommen. Die Gärtnerei kann bereits mit einem Blumenkasten auf dem Balkon beginnen oder einem kleinen Fleckchen Erde in einem grösseren Garten.
Gerade deshalb ist der Garten auch der Ort, an dem Menschen, die ihre Kräfte, ihre Kreativität und vielleicht auch ihr Selbstvertrauen aus irgendeinem Grund verloren haben, gesunden. Eine kleine Runde drehen, ein paar Minuten beim Laub wegmachen helfen oder beim Erdbeerpflücken dabei sein – das können erste Schritte zurück in die Selbstwirksamkeit sein.
Christina Brudereck hat diese leise, heilende Grünkraft des Gartens und der Natur in in zarte Worte gepackt (Trotzkraft, S. 54):
Grünkraft
Die englische Rose bewundern.
Den Duft von gemähtem Gras einatmen.
Im See baden.
Moos unter den Füßen spüren.
Salat schneiden und Kräuter.
Glatte Petersilie, Rauke, Mangold, Minze.
Mich an einen Baum lehnen.
Hochsehen ins Blätterdach.
Einen Specht hören.
Einen Milan mit den Augen verfolgen.
Blumen pflanzen, pflücken, verschenken.
Spazieren gehen.
Eine kleine Runde. Eine große.
An einem Bach entlang. Im Regen.
Kastanien sammeln.
Gemüse putzen, garen, würzen.
Brokkoli, Blattspinat, Zucchini.
Holz stapeln. Feuer machen.
Die heilsame Kraft der Natur aufspüren.
Literaturhinweise:
Christina Brudereck: Trotzkraft. Gedichte. Notizen, Essays. Gebete. Essen 2025.
Margit Eckholt: Was ist ein Garten? Gedanken einer Theologin, in: Erbe und Auftrag. Benediktinische Monatsschrift EuA 85 (2009), S. 258-269.
Michael Gassmann: Kisten und Saatbomben. Was Urban und Guerilla Gardening über unser Verhältnis zum Garten sagt, in: Internationale katholische Zeitschrift „Communio“ IKaZ 46 (2017), S. 401-402.
Uwe Habenicht: Draußen abtauchen. Freestyle Religion in der Natur, Würzburg 2022.
Brigitte Schäfer (Hrsg.): Gestaltete Lebensräume. Gärten als Orte der Verwandlung, WerkstattBibel 8, Stuttgart 2005.
Karl-Heinz Steinmetz: Paradies im Quadrat. Spiritualität des Gartens bis zum Beginn der Neuzeit, in: Internationale katholische Zeitschrift „Communio“ IKaZ 46 (2017), S. 372-381.
Holger Zaborowski: Gärten. Orte des Menschlichen, in: Internationale katholische Zeitschrift „Communio“ IKaZ 46 (2017), S. 392-40.
Foto von Alfo Medeiros auf pexels.com
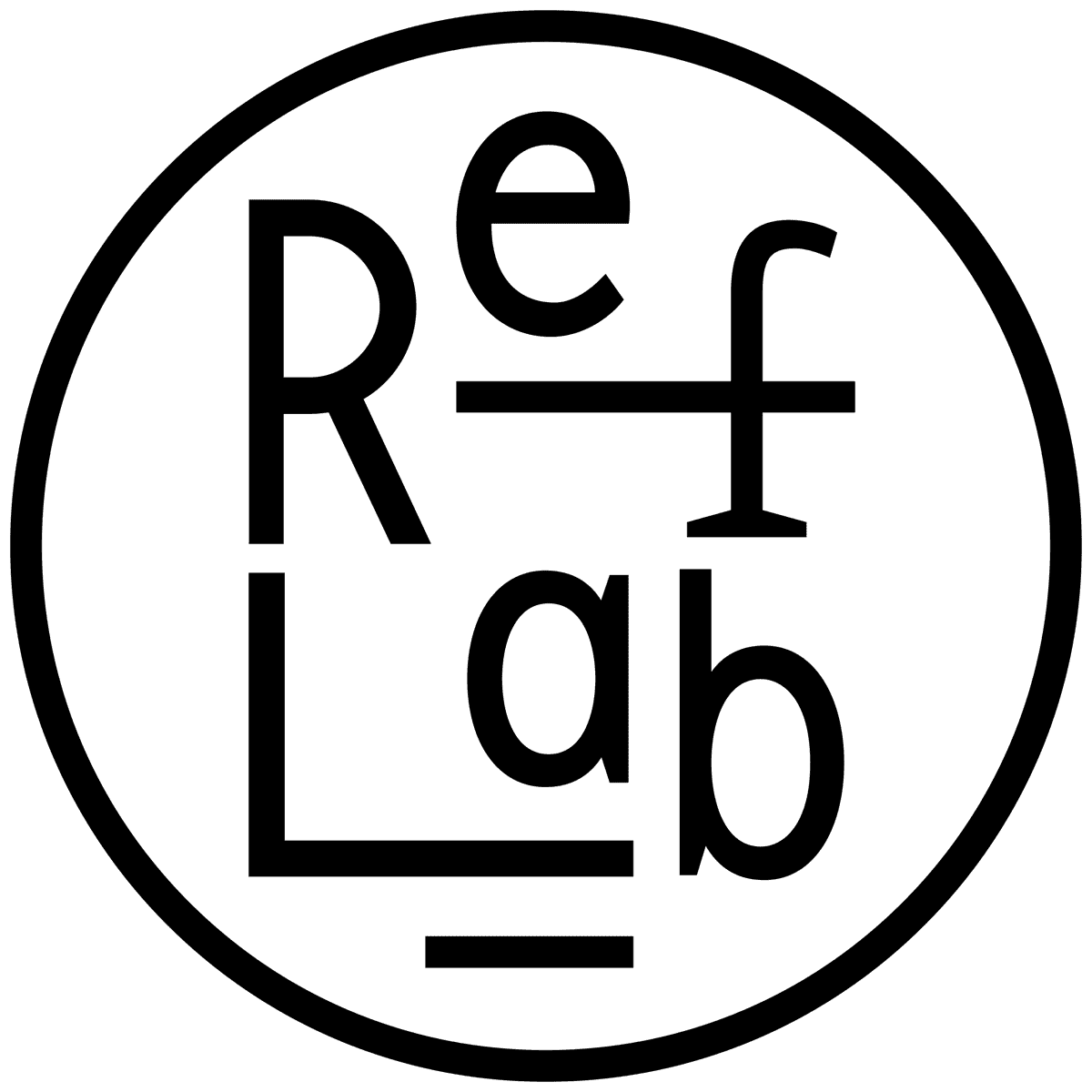






1 Gedanke zu „Erde unter den Fingernägeln: Gärtnern macht menschlich und ist göttlich“
“Gärtnern macht menschlich und ist göttlich”
Gärtnern ist menschlich, im “Schweiße des Angesichts”, und könnte göttlich machen.
☝️🙂