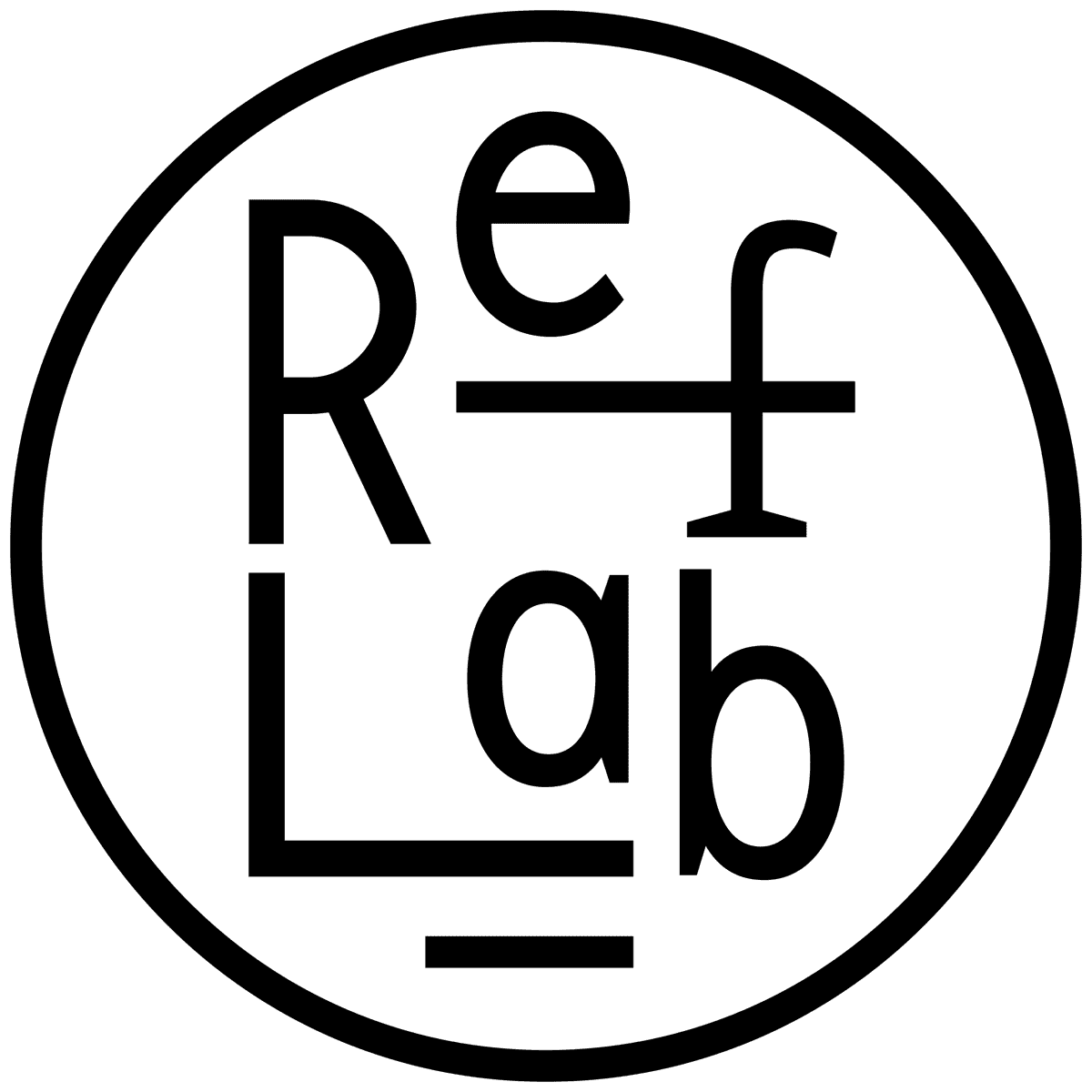In Zürich gibt es «Zigeunerkulturtage», gefördert von der Stadt. Und es gibt auch ein «Zigeuner-Kulturzentrum» des «fahrenden Volks» – offiziell so benannt. Die Einrichtungen sind schon etwas älteren Datums. Inzwischen sind unsere Sensibilitäten gewachsen.
Wir vermeiden das Z-Wort, weil es als verletzend wahrgenommen werden kann. Und das ist richtig.
Was aber, wenn Betroffene sich selbst weiterhin so nennen wollen? Es sogar als positive Selbstbezeichnung empfinden? Und stolz darauf sind?
Ein Eklat in Zürich um eine jenischstämmige Autorin, Isabella Huser, und ihr neues Buch «Zigeuner» führt einen solchen seltenen, aber aufschlussreichen Fall vor Augen.
Auf Anweisung der städtischen Antidiskriminierungsstelle verschwand das Z-Wort auf Einladungen zu einer Buchpräsentation Husers. Und dies offenbar ohne Rücksprache mit der Autorin.
Für die Schriftstellerin ist die Löschung eine Zumutung – für den Bilgerverlag ein «grotesker Zensurentscheid».
Schutz oder Bevormundung?
Die Fachstelle argumentiert mit Sensibilität: Niemand solle sich verletzt fühlen.
Aber wessen Gefühle stehen hier im Zentrum?
Die Autorin hat den Titel bewusst gewählt. Von Seiten der jenischen Community gibt es offenbar keine Proteste. Isabella Huser steht auch nicht im Verdacht, unbedacht mit Sprache umzugehen. Huser gehört selbst der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus an.
In ihrem Roman arbeitet sie die eigene Familiengeschichte auf, in der behördliche Zwangsmassnahmen und Flucht eine Rolle spielen.
Die Paradoxie springt ins Auge: Eine Antirassismus-Behörde schreitet auch ein, wenn es um eine Selbstbezeichnung Betroffener geht.
Was als Schutz gedacht ist, wirkt wie Paternalismus – und liefert den Gegnern von «Political Correctness» und «Wokeness» willkommene Munition.
Recht auf paradoxe Selbstbehauptung
Huser wählte den Titel «Zigeuer» nach eigenen Aussagen nicht als Provokation, sondern als Affirmation. Ihr Vater hatte den Ausdruck mit Stolz verwendet.
Als Kind dachte sie sogar, ihr Volk heisse «Stolizigüüner».
Begriffe mit schmerzhafter Geschichte können auch angeeignet, ironisiert, umgedreht werden. Die Wiener Tschuschenkapelle hat es vorgemacht; «Tschuschen» als abwertender Begriff für Balkanbewohner – bis heute einer der coolsten Bandnamen überhaupt, finde ich.
Es existieren auch Beispiele, wo eine Selbstbezeichnung trotz belasteter und gewaltvoller Geschichte bleibt.
«Juden» etwa ist kein Schimpfwort, sondern bis heute die geläufige Selbstbezeichnung.
Euphemismus-Tretmühle
Sprache hat Macht, zweifellos. Doch Sprachpolitik stösst immer wieder an Grenzen. Wenn dies passiert, hilft Panik nicht weiter, sondern die Einsicht, es mit einer tief liegenden Problematik zu tun zu haben.
Diskriminierende und rassistische Ausdrücke normalisieren Unterdrückung und Stigmatisierung von Minderheiten («Man wird das ja wohl noch sagen dürfen!»).
Verletzende Ausdrücke zu unterlassen, versteht sich eigentlich von selbst.
Wenn sich aber problematische Haltungen hartnäckig halten und sich soziale und gesellschaftliche Probleme nicht lösen, führt das Ausweichen auf Ersatzworte mitunter dazu, dass die neuen Worte die alten Stigmata erben.
So entsteht die bekannte «Euphemismus-Tretmühle».
Wer darf bestimmen?
Ein Berliner Beispiel illustriert das Dilemma: Im dortigen ethnologischen Museum sollte vor einigen Jahren (im Rahmen des «Humboldt Lab») ein togolesischer Vodún-Priester* ein Ritual abhalten.
Es war der ausdrückliche Wunsch des Priesters, innerhalb des Museumsrahmens seine Kultur so zu zeigen, wie sie gelebt wird. Er hoffte, Klischees aufzulösen.
Kurz vor der Eröffnung aber wollte das Museum einen Rückzieher machen – die Angst, er könne als «exotischer Fetischpriester» wirken, überwog. Die Angst vor einer durchaus möglichen Schlagzeile:
«Ethnologisches Museum stellt Voodoo-Priester aus.»
Der Priester durfte schliesslich das Ritual durchführen. Allerdings durften er und seine Gemeinde nicht wie geplant trommelnd durchs öffentliche Museum ziehen. Die togolesische Community fühlte sich durch das institutionelle Einschreiten gekränkt und diskriminiert.
Wie anders dürfen Andere sein?
Solche Beispiele mögen rar sein, aber sie werfen eine wichtige Frage auf:
Wer darf bestimmen, wie Minderheiten sich selbst zeigen – wie «anders» sie sein dürfen?
Im Zürcher Fall soll das Z-Wort in städtisch unterstützten Veranstaltungen nicht mehr verwendet werden, in Moderationen darf Husers Buchtitel nicht ausgesprochen werden. Das Buch «Zigeuner» aber darf im städtischen Kontext ausliegen und verkauft werden. Eine Inkonsistenz, die Ausdruck eines schwer zu lösenden Dilemmas ist.
Die Autorin Isabella Huser möchte das Wort nicht als Fremdbezeichnung für Jenische, Sinti, Roma oder auch ausländische Arbeiter hören, verständlicherweise.
Sie möchte aber keinen generellen Bann. Gegenüber der NZZ erklärte die Schriftstellerin:
«Die Leute müssen frei sein in ihrer Sprache und der Wortwahl». Jeder dürfe dieses Wort benutzen, wenn es respektvoll geschehe.
Mit ihrem Roman möchte Isabella Huser Aufklärung leisten: «Die Verfolgung der Jenischen, heute als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannt, ist ein Stück Schweizer Geschichte, über das viele Leute wenig Bescheid wissen oder sogar noch nie etwas gehört haben.»
* Für westafrikanischen Schamanismus wird inzwischen eher der Begriff «Vodún» verwendet.
Ausstellungstipp: Bernisches Historisches Museum, «Vom Glück vergessen. Fürsorgerische Zwangsmassnahmen in Bern und der Schweiz, bis 11. Januar 2026.