In einem Garten über Gärten schreiben
Hinter mir liegen zwei Wochen, die ich in den einsamen Hügeln der Ardèche verbracht habe. Das schöne Anwesen eines befreundeten Ehepaares zieht mich seit Jahren in seinen Bann. Die erste Woche war ich allein, forschte und schrieb an dieser Miniserie zu einer Spiritualität des Gartens.
Bisher hatte ich diesen Ort eher als Natur wahrgenommen. Aber jetzt: Die frisch gepflückten Aprikosen, die letzten Erdbeeren, üppige Kräuter, neu gepflanzte Olivenbäume, Palmen und Blumen um den Pool, immergrüne Steineichen, ein zart rauschender Bach, alte Natursteinmauern, der Schutzzaun für die Wildschweine, Tröpfchenbewässerung und mähbedürftiger Wildwuchs auf den grünen Wegen und Terrassen.
«Was für ein Segen», dachte ich. «Ich sitze gerade in einem Garten und erlebe das, worüber ich schreibe!»
Arbeiten bis zum Umfallen
In der zweiten Woche haben wir gemeinsam für mehr Sonnenlicht auf den neu gepflanzten Olivenbaumterrassen gesorgt. Eine stattliche Steineiche musste dafür weichen. Motorsäge, Axt, dünne und dicke Äste, schwere Stammstücke, Spalten und Stapeln. Nach zwei Tagen schauten wir auf eine vier Meter lange Brennholzmauer, die mir bis an die Brust reichte. Und auf sonnige, frisch gemähte Natursteinterrassen mit kleinen Olivenstämmchen. Lange habe ich mich körperlich nicht so verausgabt.
Was für eine glückselige Müdigkeit! Und was für ein Genuss, abends im Garten zu essen, zu trinken, das Tagwerk zu betrachten und Ruhe zu finden. Meine Arbeit hatte den Garten verändert, und der Garten mich.
Gärten sind Orte der Verwandlung
Die meisten Gärten sind abends anders als morgens. Ständig wandelt sich der Garten, wenn auch oft unmerklich langsam: Pflanzen entfalten sich und falten sich wieder zusammen. Wachsen, Reifen und Vergehen sind Dauerprozesse. Und wir Menschen gestalten den Garten sichtbar um. Dabei geschieht aber auch eine umgekehrte Transformation – vom Garten her auf den Menschen hin:
“Geschichten, die in Gärten spielen, geben den beteiligten Personen Raum für eigene innere Wandlungen.” Schäfer, S. 7
Wandelt sich im Garten unser Zeitempfinden?
Die Verwandlung, die ich an mir selbst beobachtete, betraf mein Zeitempfinden. Wie kamen so viel Ruhe und Gelassenheit in mein Arbeiten? Wie konnten wir uns derart anstrengen und so viel leisten, ohne dabei hektisch oder gestresst zu sein? Warum wusste ich nie so ganz genau, wie viel Uhr es war? Tickt die Zeit im Garten anders oder ticke ich anders während der Gartenzeit?
Wenn sich Zeitfeindschaft in Zeitfreundschaft wandelt
Gärten können auf vielfältige Weise und mit guten Gründen Stress auslösen. Und doch ist es erstaunlich, wie leicht sich unser temporales Empfinden im Garten ändern kann. Die Zeit hört auf, eine Ressource zu sein, die uns zwischen den Fingern zerrinnt und von der wir immer zu wenig haben. Die angstgetriebenen Zwänge, der Zeit nachzujagen, sie zu beschleunigen und mit überlappenden Erlebnisepisoden zu verdichten, erschlaffen. Deadlines müssen wir genauso wenig fürchten wie die Zeit totschlagen.
Gärten verwandeln unser Zeitempfinden. Aus der Feindin Zeit, die gegen uns arbeitet, wird eine Freundin, die uns gegenwärtig sein und verweilen lässt. Das chronologisch-quantitative Erleben von Zeit wird ausgeweitet auf ein kairologisch-qualitatives.
Wie wurde unser Verhältnis zur Zeit immer aggressiver?
Ich glaube, im umhegten und geschützten Gartenraum – altpersisch pairi-daé-za – bewahren wir uns etwas, das wir unterwegs verlieren können.
Die unterschiedlichen soziologischen und philosophischen Zeitdiagnosen sind sich weitgehend einig, dass wir an einer pandemischen Zeitknappheit leiden. Sie geht mit dem Gefühl einher, die Zeit vergehe immer schneller, so dass wir nicht hinterher kommen.
Dabei müssten wir eigentlich aufgrund der technischen Möglichkeiten, durch die wir ja Zeit sparen, mehr Zeit übrighaben.
Die Beschleunigung des Lebens
Hartmut Rosa versucht, dieses Phänomen als Beschleunigung des Lebens zu erhellen. Er definiert sie als „Mengensteigerung pro Zeiteinheit“. Angetrieben wird diese Beschleunigung durch unterschiedliche Motoren. Etwa einen kulturellen, wenn wir glauben, dass ein gelingendes Leben von Ressourcen abhängt, die wir haben und verbessern müssen: Gesundheit, Wohlstand, Schönheit, Fitness, Bildung, soziale Beziehungen, Anerkennung, Status, Weltreichweite (Mobilität und Konnektivität), Sicherheit.
Mehr macht glücklich
Wir sind daher fixiert auf die Verbesserung unserer Ressourcenausstattung.
Was das Ganze beschleunigt, ist ein sozialer, markwirtschaftlicher Motor. Ressourcen werden zugeteilt nach dem Prinzip des Wettbewerbes und der Konkurrenz.
Wer schneller ist, bekommt entsprechend mehr Ressourcen. Sie bieten uns dann die Möglichkeit, mehr zu erleben.
Ein ewiges Leben vor dem Tod
Die Herausforderung besteht allerdings in der begrenzten Lebenszeit, die uns zur Verfügung steht. Rosa spricht an dieser Stelle von „Ewigkeitsverlust“:
Wer die Verheissung auf ein Leben nach dem Tod verloren hat, ist dazu gezwungen, ein ewiges Leben vor dem Tod zu leben.
Konkret heisst das: Wir verdichten die Zeit, bearbeiten gleichzeitig mehrere Aufgaben oder packen die Tage mit mehr Erlebnissen voll, die in immer kürzeren Raten oder überlappend stattfinden.
Ein Garten kann der Zeit Halt bieten
Die schädlichen Folgen dieser zeitaggressiven Art zu leben, müssen hier nicht noch mal erwähnt werden.
Wichtiger ist, dass wir mit unseren Gärten immer noch Orte haben, an denen die dahinrasende und schwirrende Zeit zu einem Halt kommen kann. Orte, die wir so kultivieren, dass unsere Zeit darin gehalten ist und wir gehalten in der Zeit.
Die biblischen Geschichten aus dem Urgarten in Eden halten die Zeit heilig und machen sie zur ersten Kreatur, die von Gott heiliggesprochen wird (1Mose 2,3). Sie bezeugen uns die grosse Sehnsucht nach einem Ort, an dem wir mit allen Kreaturen zur Ruhe finden. Ja, an dem Gott selbst zur Ruhe kommt und wir in seiner Gegenwart selbst gegenwärtig und ruhig werden.
In Ruhe arbeiten
Gartenarbeit macht müde – selig müde. Also weder matt noch erschöpft, so wie der Speed des Hamsterrades. Denn es läuft der Naturhaftigkeit eines Gartens zuwider, wenn man ihn beschleunigen will. Klar, es gibt Situationen, in denen Arbeiten angepackt und auch zeitig erledigt werden müssen. Weil plötzlich das Wetter umschlägt, die reife Frucht geerntet werden muss.
Aber Gartenarbeit richtet sich nicht nach einer Steigerungslogik, sondern danach, Wachstum zu ermöglichen, das letztlich unverfügbar bleibt. Gute Gärtner:innen hören und spüren, wann welche Arbeiten möglich und dran sind.
Und für viele Projekte ist es auch gar nicht entscheidend, ob sie heute oder morgen fertig werden. Aufgrund solcher Faktoren können wir uns gärtnernd verausgaben, ohne dabei auszubrennen. Weil wir aus einer gewissen Grundruhe heraus ans Werk gehen.
In Ruhe lassen
Ein Garten nimmt sich Zeit und animiert uns so dazu, es ihm nachzumachen. Ja, ein Garten zwingt uns in gewisser Weise zur Ruhe, weil er Ruhe braucht.
Denn das, was aufblüht, wächst und reift, macht weder Lärm noch Stress. Es wird, indem es nicht nur leidenschaftlich gepflanzt und gepflegt, sondern auch hingebungsvoll in Ruhe gelassen wird.
Eine Ruhe, die aus den Rhythmen von Saat und Ernte, Werden und Vergehen, Tag und Nacht, Frühling und Sommer und Herbst und Winter entsteht.
Zur Ruhe finden
Für viele Menschen fühlt es sich an, als ob sie in die Ruhe des Gartens hineingezogen werden. Egal, ob sie in ihm tätig oder zu Gast sind.
Die Notwendigkeit, den Garten in Ruhe zu lassen, geht über in die Freiheit, ja, die Freude zur Ruhe kommen zu dürfen.
Dies geschieht dann, wenn in der eben skizzierten Rhythmik Dinge oder Prozesse zum Abschluss kommen. Die Blumen sind zum Blühen gekommen – wir halten inne und betrachten sie. Der Rasen ist dicht gewachsen und gemäht – Zeit, ihn zu bespielen. Obst und Gemüse sind geerntet – wir geniessen. Der Abend kommt – wir beschauen das Tagwerk und sagen: Gut so, gut jetzt, morgen ist ein neuer Tag.
Die Zeit des Gartens atmen
Ich war in diesem Sommer auf der Suche nach den transformativen Kräften, durch die uns der Garten ein anderes Zeitempfinden zuwachsen lässt. Nicht nur in Büchern, sondern im sinnlichen Erleben eines echten Gartens. Zum Glück, denn nur so erfuhr ich, dass der Garten mir Zeit zuatmen kann, und zwar indem er duftet. Die Lyrik von Rose Ausländer kann das vielleicht besser sagen, als ich es gleich ein wenig philosophisch versuche:
Im Garten
atmet die Zeit
freier
Ich atme ein
Ihren Duft
Er atmet
mich aus
Die Zeit des Gartens duftet
Damit Düfte überhaupt entstehen, braucht es Zeit: Verdunstender Regen, moderndes Holz, trocknendes Gras, aufgehende Blüten, heraufziehender Abendhauch, wachsende Kräuter, gereifte Erdbeeren.
Wir haben zwar kein Sinnesorgan für die Zeit, aber vielleicht kann man ja doch sagen: Die Zeit duftet und wir können sie schnuppern.
Im Duft des Gartens die Zeit kosten
Wenn wir nun einem sich verströmenden Duft im Garten nachschnuppern, geschieht etwas mit unserer Zeit. Erinnerungen und Bilder aus der Vergangenheit füllen unsere Gegenwart und werden zu einem narrativen Gebilde verwoben, in das ich mich einrahme. «Das von der Dissoziation bedrohte Ich», so der Philosoph Byung-Chul Han, kehrt zu sich zurück.
«Wo es duftet, sammelt es sich.» Han, S. 50
Wir halten inne und verweilen, denn hastig kann niemand einem Duft folgen. Die Zeit bleibt stehen, wir sind ganz da und gegenwärtig, als ob wir sie kosten würden.
Im kleinen Paradies die grosse Vision pflegen
Wer einen Garten pflegt oder besucht, kann erleben, dass unser aggressives Zeitverhältnis versöhnt und unsere spätmoderne Zeitnot geheilt werden können.
Ohne religiös vereinnahmen zu wollen, glaube ich, dass sich heute in vielen Gärten die stille Sehnsucht nach einem Garten in Eden zeitigt, in dem die Uhren freier ticken.
Dabei geht es nicht um die Rückkehr in ein angeblich vollkommenes, aber leider verlorenes Paradies. Es geht um ganzheitliche Erfahrungen, die in uns Visionen einer «paradiesischen» Zukunft wecken und lebendig halten. Grünsüchtige bleiben deshalb nicht in ihren Gärten. Sie probieren die Grühn- und Blühkräfte jenseits ihrer Gärtenzäune aus. Auf dass die Zeit nicht mehr so schwirren und rasen muss.
Literaturhinweise:
Evelyne Baumberger: Terra Divina. In der Natur auf Gott hören auf reflab.ch. Eine Anleitung zu einer spirituellen Übung in der Natur oder im Garten.
Margit Eckholt: Was ist ein Garten? Gedanken einer Theologin, in: Erbe und Auftrag. Benediktinische Monatsschrift EuA 85 (2009), S. 258-269.
Byung-Chul Han: Duft der Zeit. Ein philosophischer Essay zur Kunst des Verweilens, Bielefeld (12. Auflage) 2015.
Hartmut Rosa: Gelingendes Leben in der Beschleunigungsgesellschaft. Resonante Weltbeziehungen als Schlüssel zur Überwindung der Eskalationsdynamik der Moderne, in: Kläden, Tobias / Schüßler, Michael (Hg.): Zu schnell für Gott?, Freiburg 2017, S. 18-51.
Brigitte Schäfer (Hrsg.): Gestaltete Lebensräume. Gärten als Orte der Verwandlung, WerkstattBibel 8, Stuttgart 2005.
Foto von Kelly auf www.pexels.com
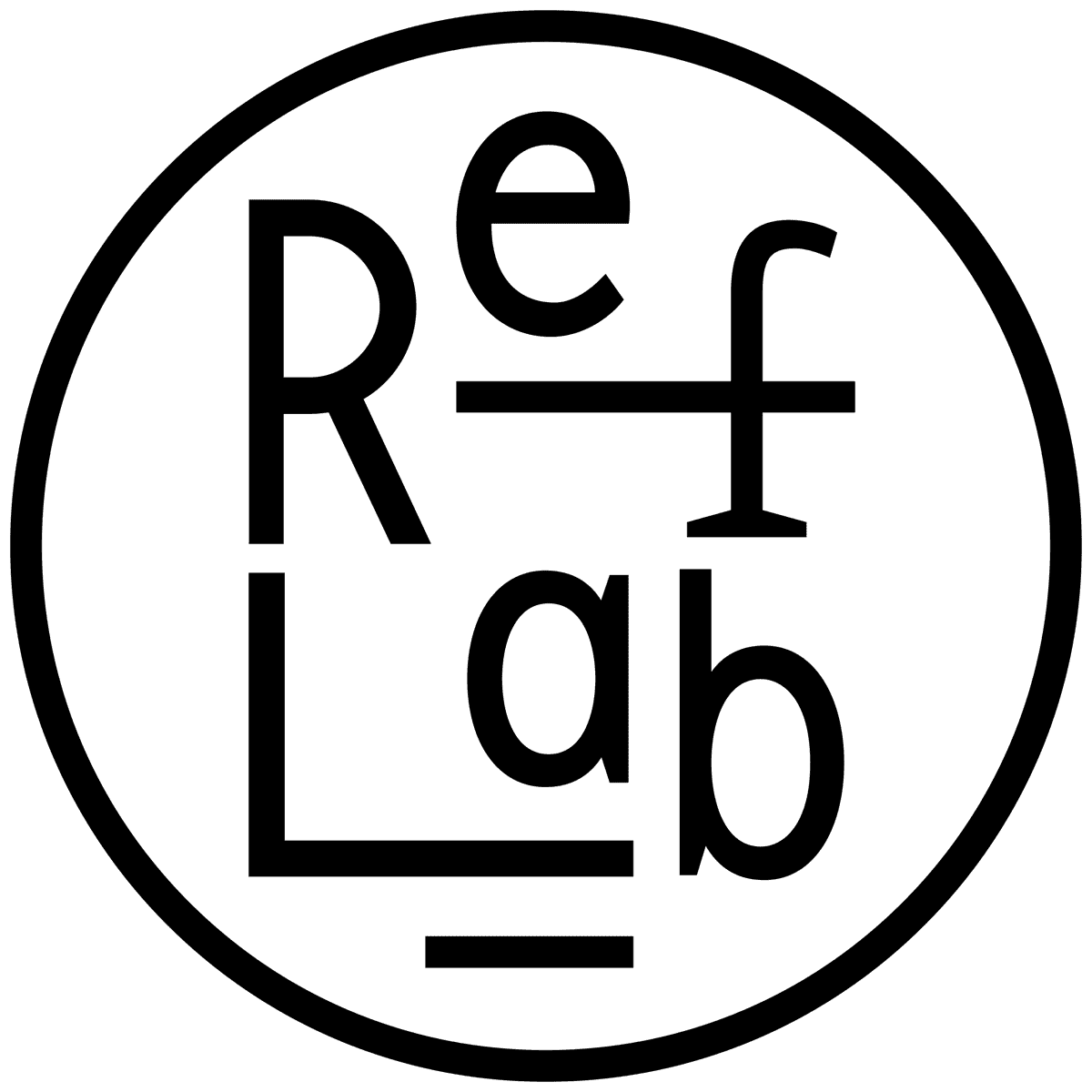








2 Gedanken zu „Der Uhrgarten in Eden und die Zeitnot unserer Gegenwart“
“Wie wurde unser Verhältnis zur Zeit immer aggressiver?”
Der irrationale und bewusstseinsbetäubende Zeit-/Leistungsdruck des nun “freiheitlichen” Wettbewerbs um die Deutungshoheit der wettbewerbsbedingt-konfusen Symptomatik, wird erst dann auf ein vernünftiges/gottgefälliges Maß der Bewusstseinsentwicklung zurückkommen, wenn der stumpf-, blöd- und wahnsinnige Kreislauf des stets und überall gleichermaßenen imperialistisch-faschistische Erbensystems und die heuchlerisch-verlogene Schuld- und Sündenbocksuche zum Verantwortungsbewusstsein als ganzheitlich-ebenbildliches Wesen Mensch findet – Auszeiten in der NOCH vorhandenen Natur, sind auch nur Bewusstseinsbetäubung, wenn die ignorante Arroganz des Wohlstands- und Gewohnheitsmenschen in gleichermaßen unverarbeitet-instinktiver Bewusstseinsschwäche in Angst, Gewalt und egozentriert-gebildetem “Individualbewusstsein, nicht wirklich-wahrhaftig ganzheitlich OHNE … überwunden wird.
Ein Garten hat auf uns eine sehr positive Wirkung weil er uns entschleunigt und viel über das Leben und die Zeit lehrt: Die Veränderung im Jahresverlauf erinnert uns an die großen Zyklen des Lebens – Geburt – Wachstum – Erntezeit – Absterben und nach dem Winter ein erneuter Neubeginn. Die Blütenkelche macher Blumen öffen sich morgens und schließen sich in der Nacht – zudem können je nach Tageszeit unterschiedliche Vögel gehört werden.
Dies zu beobachten hilft sehr gut um Stress abzubauen – denn dem Garten und seinen Bewohnern ist unser Stess egal: man muss abwarten und zusehen/hören,
Zum Thema ´Zeit´ noch eine Anmerkung: Bischof Augustinus unterschied schon vor 1600 Jahren (in ´Bekenntnisse´, Buch11, Kap.13-29) drei Typen: a) göttliche, b) physikalische bzw, c) menschliche Zeit bzw. Zeitwahrnehmung.
In unsere heutige Sprache übersetzt:
a) göttliche Zeit: Gott ist zeitlos = d.h. für ihn gelten keine physikalischen Gesetze oder menschliche Vorstellungen
b) physikalische Zeitvorstellung = ´Zukunft´ und ´Vergangenheit´ kann es nicht geben, denn wenn es diese Zeiten gleichzeitig mit der ´Gegenwart´ geben würde, wären alle Ereignisse ebenfalls der ´Gegenwart´ zuzuordnen. Diese ´Gegenwart´ hat allerdings keine Dauer (“nicht die Geringste”, wie er betont) = d.h ´Gegenwart´ ist nur eine imaginäre Grenze des Übergangs, an der sich alle Veränderungen im Universum ereignen.
c) menschliche Zeitwahrnehmung = dass die physikalische ´Gegenwart´ keine Dauer hat, wir aber ´Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit´ deutlich empfinden und unterscheiden können, machte Augustinus schwer zu schaffen. Er löste dieses Problem mit der klugen Überlegung, dass dies Wahrnehmungen dieser Zeiten ein Produkt unserer Gedanken, unserer Phantasie sein müssen – was er als ´Ausdehnung des Geistes´ bezeichnet.