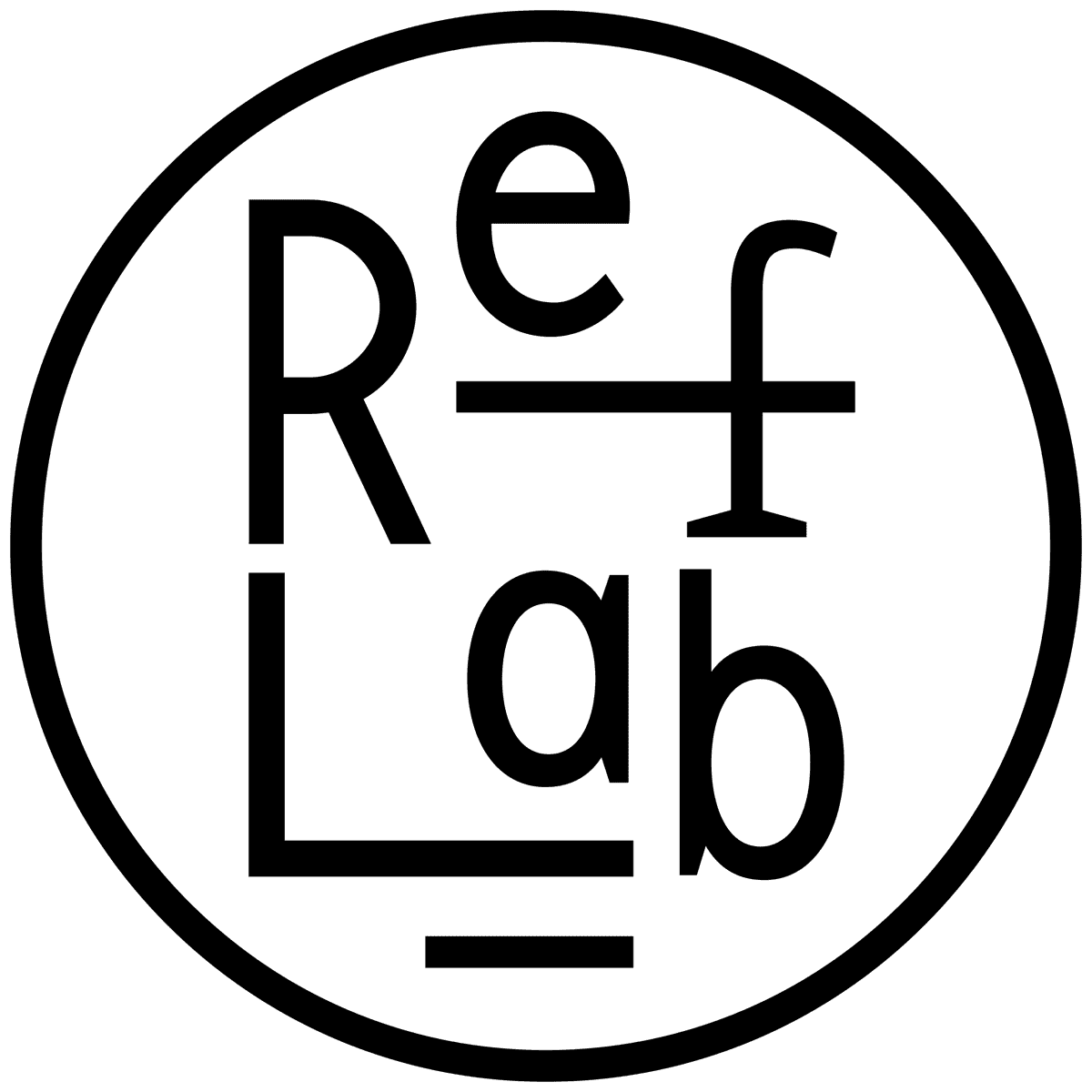Wer bekommt das Recht, die eigene Geschichte, die eigene Wahrheit zu erzählen? Sind es die besonders lauten oder die besonders mächtigen Menschen?
Sind es die mit besonders viel Reichweite, oder nach wie vor die stereotypen alten weissen Männer. Die mit den Tech Firmen, in den grossen Gebäuden, die mit ihren massgefertigten Schuhen über die massgefertigten Teppiche stolzieren und an ihren massgefertigten Schreibtischen über ihre massgefertigten Medienanstalten diskutieren.
Heute ist internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen. Nach wie vor erlebt fast jeden vierte Frau weltweit geschlechtsspezifische Gewalt. Sie wurden, sind und werden Opfer einer Gesellschaft, die Männlichkeit mit Stärke, Macht und auch Gewalt gleichsetzt.
Es sind die selbstgewissen Geschichtenerzähler, die vorgeben, welche Märchen den Menschen erzählt werden. Und damit wiederholt sich die Geschichte, leider. Grund genug, mir die Frage zu stellen, welche Geschichten von Frauen erzählt werden – und von wem.
Was braucht es, dass eine Frau gehört wird? Müssen Frauen nach wie vor zunächst eine patriarchal geprägte Heldenreise erleben, um dann auch ihre Sicht auf Geschichte verlautbaren zu dürfen?
Die eigene Geschichte erzählen zu können ist eine Form von Selbstermächtigung. Ich habe die Deutungshoheit über die Dinge, die in meinem Leben passiert sind – ich entscheide, wann ich Opfer und wann ich Täterin war – ich erzähle meine Wahrheit. Nicht die Wahrheit, diese Formulierung ist entscheidend, sondern meine Wahrheit.
Die Wehrlose
Es war einmal eine Frau, die litt viele Jahre unter körperlichen Symptomen, wie Schwindel und Übelkeit. Sie hatte diverse Infektionen und Entzündungen. Die Ursache für die immer wiederkehrenden Symptome fanden die Ärzte jedoch nie heraus. Dabei führte die Frau ein unaufgeregtes, schönes Leben in Südfrankreich, mit ihrem Mann und ihrer Familie.
Gisèle Pelicots Geschichte ist die Geschichte einer Frau, die sich nicht in eine Rolle drängen lässt. Gisèle Pelicot war Nebenklägerin und Opfer in einem Vergewaltigungsprozess. Aber sie hat sich nicht als Opfer inszeniert und sorgte damit für sehr viel Aufsehen. Opfer sein, heisst nicht, in eine Opferrolle fallen zu müssen.
Vor zirka einem Jahr sind die Urteile gegen die Angeklagten gefallen. Verurteilt wurden über 50 Männer. Ihr Ehemann Dominique Pelicot hatte seine Frau «über zehn Jahre hinweg […] regelmäßig […] mit schwersten Angstlösern und Schmerzmitteln betäubt und im Internet anderen Männern zur Vergewaltigung angeboten.»
Das Einzige, worunter Gisèle offenkundig litt, waren körperliche Symptome wie Schwindel oder wiederkehrende Entzündungen. Erst durch ein kleineres Delikt ihres Mannes, sind die jahrelangen Vergewaltigungen Pelicots aufgedeckt worden.
Im Prozess hat sich Gisèle Pelicot dafür eingesetzt, dass der Prozess öffentlich stattfindet und auch die Beweise, Videos und Bilder öffentlich vorgeführt wurden.
Die Zustimmende
Ihr Fall hat nicht minder dazu beigetragen, dass die unterschiedlichen Formulierungen im Sexualstrafrecht in den Fokus der Öffentlichkeit gerieten. Handelt es sich um Vergewaltigung, wenn die Frau sich nicht äussert (/n kann)?
Unter den Hashtags #NurJaHeisstJa oder auch #NeinHeisstNein ist besonders in den sozialen Medien geschlechtsspezifische Gewaltausübung in Form von sexuellen Übergriffen und sexueller Nötigung und Gewalt diskutiert worden. Die öffentliche Diskussion hatte auch Folgen für die Gesetzgebung und damit den Schutz von potentiellen Geschädigten.
Braucht es ein formuliertes Nein oder reicht es schon, wenn kein ausdrückliches Ja zu einem sexuellen Kontakt gegeben wird? Nur Ja heisst Ja, oder grundlegender: Wie stimme ich einer Handlung zu, wie signalisiere ich meine Ablehnung?
Die Geschichte eines sexuellen Übergriffs kann nämlich auch ganz anders erzählt werden. Es ist einfach, Übergriffigkeiten als Komplimente zu missdeuten.
Die Nette
Es war einmal eine Frau, die war ein sehr freundlicher Mensch, höflich und nett zu allen. Sie hatte es so gelernt, sie gefiel sich so. Sie mochte es nicht, Menschen zurechtzuweisen, auch nicht, wenn sie ihr zu nahe getreten sind.
Das war sicherlich keine böse Absicht. Der wollte mir doch nur schmeicheln. Ich habe eben einen schönen Körper, kann ich ihm nicht verübeln, dass er den berühren wollte. Ist bestimmt nur nett gemeint. Und so ein bisschen Aufmerksamkeit tut mir auch ganz gut.
Einen Übergriff anzuzeigen oder zumindest darauf aufmerksam zu machen ist eine enorme Hürde für viele Frauen. Ich schreibe das, weil ich es weiss. Aus eigener Erfahrung, aus kollektiven Erzählungen. #MeToo.
Vor zehn Jahren erlebte von Hundert Frauen, die vergewaltigt wurden, nur etwa eine einzige eine Verurteilung eines Täters. 85 Prozent der Frauen stellen keine Anzeige.
Und dann traue ich mich nicht mehr nein zu sagen. Ich habe ja mit der Person geflirtet und wir haben uns nett unterhalten. Natürlich kannst du noch mit zu mir kommen. Es ist mir egal, ob etwas passiert oder nicht, denn ich fühle mich gewollt und begehrt. Manchmal reicht das schon aus, um Dinge zu tun, die ich eigentlich gar nicht tun will.
Wenn der Körper und Körperlichkeit die Währung sind, um Aufmerksamkeit zu bekommen und das jahrelang so vorgelebt, propagiert wurde, dann bezahlen wir gerne. (Ich schreibe hier uns, weil ich mich einschliesse.) Um uns ein bisschen mächtiger zu fühlen. Um ein bisschen weniger fremdbestimmt zu sein. Damit wir die eigene Geschichte überhaupt erst erzählen dürfen.
Die Gefährliche
Es war einmal eine junge Magd, die wurde geköpft, weil sie Opfer einer Vergewaltigung war. Die Frau wurde von einem mächtigen Mann vergewaltigt. Ihre Herrin, in deren Haus die Vergewaltigung stattfand, war so erbost darüber, dass sie die junge Magd in ein Monster verwandelte. Mit einem Haupt voller Schlangenhaare, und jeder, der sie ansieht, erstarrt zu Stein.
Medusa ist nur ein Beispiel für eine Frau, die zunächst für ihr Frausein, später dann für ihre Macht bestraft wird. In ihrer Geschichte wird mal ihre Jungfräulichkeit, mal ihre Schönheit betont, mal das sie ihre Herrin verraten hat und für ihre Untreue bestraft gehört.
Das abgeschlagene Schlangenhaupt ist immer noch ein gern genutztes Bild, um mächtige Frauen «auf ihren Platz zu verweisen» und daran zu erinnern, dass diese Macht ihnen immer wieder entzogen werden kann.
Frauen in mächtigen Positionen werden häufig als Bedrohung wahrgenommen. Die männliche Antwort darauf ist allzu oft Sexismus und (psychische) Gewalt. Nicht nur bei Medusa, sondern immer wieder bei Frauen in wichtigen politischen Ämtern. Kamala Harris oder Sanna Marin seien hier als Beispiele genannt.
Die ehemalige finnische Ministerpräsidentin und Regierungschefin Marin hat vor kurzem ihre Memoiren veröffentlicht. Darin schreibt sie offen über den systemischen Sexismus, den sie in ihrer Amtszeit erlebt hat. Sie erzählt ihre Geschichte. Ein Ermächtigungsversuch.
In einem kürzlich erschienen NZZ-Artikel dazu wird jedoch der Sexismus fortgesetzt. Dort heisst es: «Wer es bei der Lektüre bis dorthin geschafft hat, wundert sich nicht, wieso. Marin ist anstrengend.» Und anstrengende Frauen, und solche die dann noch Bücher schreiben, sind bekanntlich gefährlich.
Die Wütende
In dem vor Kurzem erschienen Buch «Das Penismuseum» beschreibt eine Frau, wie sie Bilder von dem Penis ihres Mannes macht. Immer wenn er schläft. Daraus entsteht eine beachtliche Sammlung Penisbilder. Als die Ehe geschieden wird, macht sie aus den Bildern eine Ausstellung.
Während ich die Geschichte las, habe ich viel gelacht und innerlich immer wieder zustimmend genickt. Sie macht es richtig. Gut so. Die ganzen hässlichen Dickpics einfach mal ausstellen. Ich habe mich mit der Frau solidarisiert, unmittelbar. Ich habe ihr Handeln als Ermächtigung verstanden.
Was mich ebenso dazu bewog ihre Handlungen sofort gutzuheissen, war mein tiefliegender mehr oder minder bewusster Wunsch, ebenso zu verfahren. Es den Männern, von denen ich Gewalt erfahren habe, die mir gegenüber übergriffig gehandelt haben, heimzuzahlen. Auch wenn dies natürlich nicht der richtige Weg ist.
Denn es geht nicht um meine individuelle Rache. Kein Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es geht um die vielen kleinen Vergehen. Die unachtsamen Kommentare, die Erniedrigungen, die vermeintlichen Komplimente, die gläsernen Decken und Türen, den Sexismus, die Scham, die nicht nur ich erlebe. Sondern die vielen Frauen weltweit, die jeden Tag aufs Neue unter geschlechtsspezifischer Gewalt leiden. Jede vierte Frau.
Ich kann meine Geschichte erzählen. Aber vielen ist es unmöglich.
Zur weiteren Lektüre:
Zum Prozess und Hintergrund Gisèle Pelicots.
NZZ Beitrag zu den Memoiren Sanna Marins.
Zu Frauen und Macht: Mary Beard, Frauen und Macht, London 2017.