Gestern in einem Newsletter gelesen: «Die Reisebranche wünscht sich Orientierung hinsichtlich Vergütungsfragen».
Ist es Ihnen auch passiert? Gut, dann haben wir den Verleser der Woche bereits hinter uns. Bin froh, dass ich nicht der einzige bin. Denn viel lieber denke ich über soziologische Fragen nach: Der Mensch macht das, was andere Menschen machen. Komme ich in die S-Bahn und merke, dass alle eine Maske anhaben, ziehe ich auch eine an. Merke ich, dass die Mehrheit keine Maske trägt, streife ich meine ebenfalls ab. Normal. Ich will ja nicht auffallen. Passe mich an. Doch wie genau entsteht diese Mehrheit? Wann kippt es?
Aus der Spieltheorie (das hat nichts mit Theatersport zu tun, sondern ist ein Teilgebiet der Mathematik) wissen wir, das die kritische Masse dann erreicht ist, wenn eine bestimmte Anzahl von Teilnehmenden von einer Strategie überzeugt ist und nicht die ganze Gruppe von der Strategie überzeugt werden muss. Wird dieser Schwellenwert überschritten, die kritische Masse also erreicht ist, wird sich die Strategie selbsttragend durchsetzen.
Ich prophezeie, dass nächsten Mittwoch im Lauf des Nachmittags, sagen wir um 15:12 Uhr der Zeitpunkt eintritt, wo es kippt. Im 13er Tram nach Albisgüetli wird es überschnappen. Forscher werden im Nachhinein feststellen, dass genau dort, zwischen Stockerstrasse und Bahnhof Enge das erste Mal die 50% der Passagiere überschritten wurde, als arithmetisch gesehen die Mehrheit keine Maske mehr trug. Und niemand hat aufbegehrt. Danach ging es schnell. Quasi eine Welle. Ausgehend vom 13er Tram kippte ganz Zürich. Gleiches geschah gleichzeitig in Bern, Basel und sogar Lausanne, sprachübergreifend, überkonfessionell und parteiunabhängig. Ähnlich wie das Phänomen, wenn weltweit gleichzeitig aller Bambus blüht, so wie ein kollektives Bewusstsein.
„Am Mittwoch um 15:12 Uhr kippt es“
Die Schweiz hat ja eine gute Grösse, um solche Phänomene zu studieren.
Interessant finde ich auch die Grüezi-Variable: In Städten grüsst man sich nicht auf der Strasse. Weil es schlicht zu viele Leute hat, die einem begegnen. In Dörfern tut man’s, muss man sogar. Doch wo ist die Grüezi-Grenze? In Glarus grüsst man sich noch. Das Städtchen hat rund 6000 Einwohner. In Murten aber nicht mehr. Das zählt gegen 8500 Einwohner. Irgendwo dazwischen ist also die Grenze. Vielleicht spielt in Murten/Morat auch die Zweisprachigkeit eine Rolle.
Apropos zweisprachig: Haben Sie es auch vernommen? Dieses Bonjour überall beim Wandern. Ich mache eine schöne Tour im Entlebuch oder auf dem Stoos, kaufe einen Ice Tea, entdecke Krokusse und Alpenrosen, alles blüht, dort wo es soll, auch ich selbst, esse zwischendurch einen Cervelats, mache ein Selfie mit einem noch leicht schneebedeckten Irgendwasstock, und natürlich begegnen mir dabei andere Wanderer. Freundlich sagt man dann «Grüezi». Diese urschweizerische Formel. Eine Mischung aus Respekt, Gruss, Ausländertest, Anerkennung, Zugehörigkeit, Solidarisierung und Identitätsstiftung.
Streng ist es allerdings beim Aufwärtsgehen. Man ist vielleicht mit einem Partner unterwegs, quatscht ein bisschen über berufliche Probleme oder Beziehungen, noch besser über Corona, aber wenn dann so ein Stutz kommt und es geht ordentlich aufwärts, kommt man ins Keuchen und das Reden wird eingestellt. Jeder hängt seinen Gedanken nach, geniesst die Tour und den freien Tag.
Und genau dann kommen einem welche entgegen. Lächelnd, schon das Gipfelglück hinter sich. Und sagen so ganz nett «Grüezi». Nun, ein Grüezi kann man nicht unerwidert lassen. Das ist ein Gesetz. Sonst droht Passentzug und Ausschaffung. Mindestens. Also stammle ich ein innerlich gequältes aber äusserlich freundliches Grüezi zurück. Schlimm sind Gruppen. Und es sind IMMER Gruppen. Jeder einzelne so «Grüezi». Gopfertami. Der Weg ist eng und alle laufen hintereinander runter. Ich muss also fünfmal einzeln Grüezi stottern, fünfmal lächeln. Unter echten Wanderern weiss man um dieses Umstand. Darum ist auch ein nicht überzeugendes, gekeuchtes «’zi» akzeptiert.
Aber manchmal ist der echte Wanderer, der vor mir hochlief und jetzt wieder runterläuft kaum zu unterscheiden von den Gondelbahn-Gipfelstürmern, die nur runterspazieren. Gekleidet sind sie nämlich genau gleich. Und neuerdings also Bonjour. Haben Sie es gemerkt? Überall Welsche jetzt. Weil sie nicht weg können. Verpesten und verstopfen sie die Wanderparadiese. Ok, es sind ja auch Schweizer, irgendwie. Und ich will ja zeigen, dass ich mal in der Schule war, also kreiere ich mein schönstes Bonjour. Immer noch besser als das Grüzi von den Deutschen. Bitte, ihr Lieben, versucht es doch lieber gar nicht, es klingt – gelinde gesagt – komisch.
Und während ich beim Wandern so diesen Gedanken nachhänge, frage ich mich, ob es auf dem Gipfel statt ein Iiklämmtes nun Croque Monsieur oder ein Fischbrötchen gibt.
Wer es geschafft hat, diese Kolumne bis zum Ende zu lesen, wird nun noch mit der Empfehlung der Woche belohnt: Lest Rutger Bregman’s UTOPIEN FÜR REALISTEN – Die Zeit ist reif für die 15-Stunden-Woche, offene Grenzen und das bedingungslose Grundeinkommen.
Wann und wo sagen Sie Grüezi? Mit oder ohne Maske? Was ist die Kurzform von Bonjour? Und von wem haben Sie Ihre Meinung?
Sachdienliche Hinweise hierzu gerne an lukas.meyer@memail.com
Die nächste Kolumne ist dann entgendert, versprochen.
Mollis, 11.06.2021
Lukas Meyer ist Life-Style Empfehler, Analog Manager und Gründer der Mir-Partei
Foto von Boris Pavlikovsky von Pexels
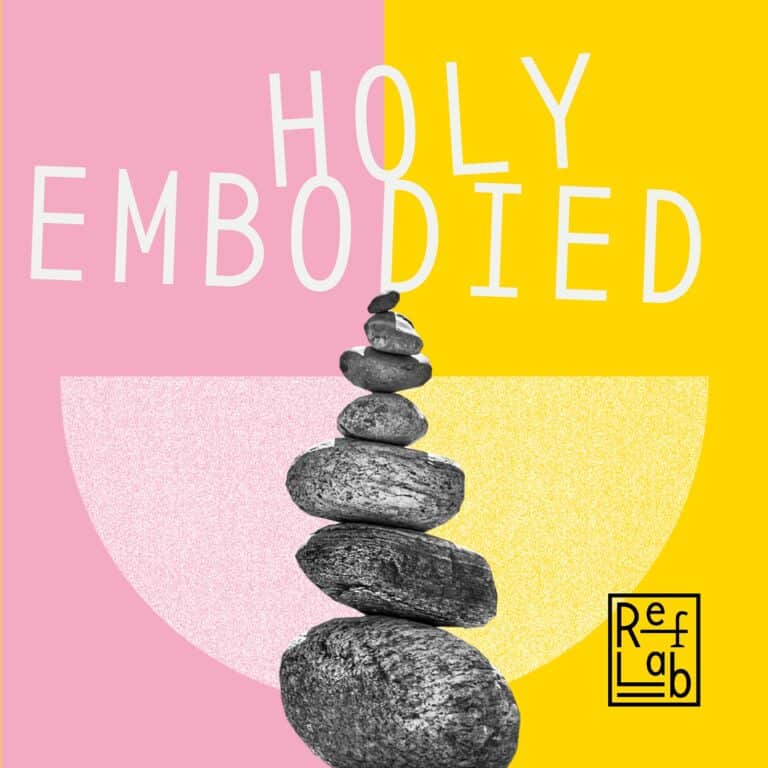
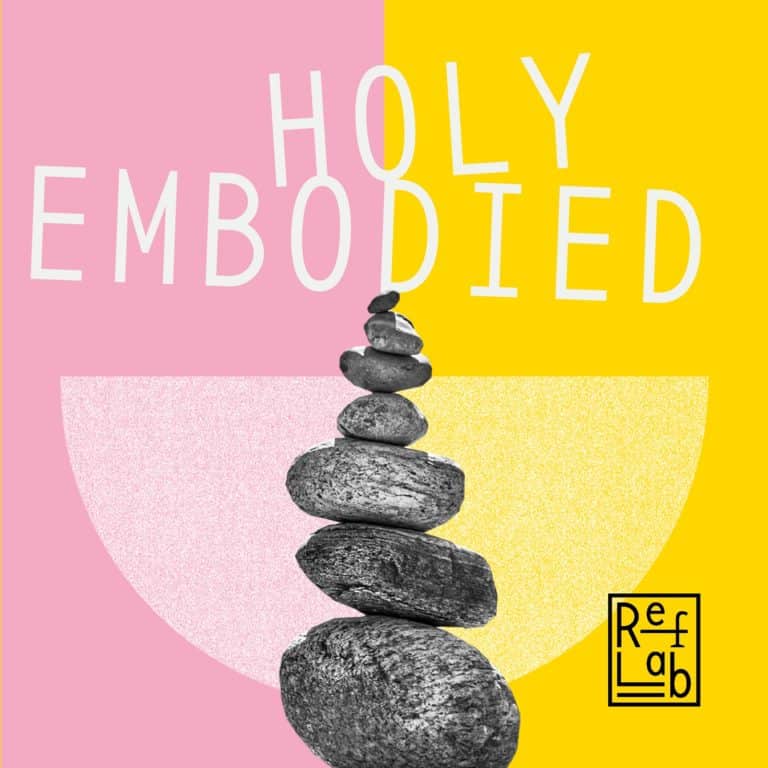






2 Kommentare zu „Wo Gott dich hingesät, da sollst du blühen“
Einmal mehr zeichnet sich L. Meyer als Dichter und Poet aus.
Auch ich gehöre zu jenen, die das «Grüezi» ein Leben lang nicht waschecht über Rachen, Zunge und Lippen bringen werden. Ich tue es trotzdem. Und das seit 40 Jahren.
Wie sollen wir «anderen und fremden» Menschen die Sprache lernen, wenn jeder Versuch als «komisch» klingend abgewertet wird? Ist das Sprechen einer Fremdsprache nur erlaubt, wenn sie akzentfrei, grammatisch lupenrein und von Muttersprachigen nicht unterscheidbar ist? Stört der unüberhörbare Akzent auch, wenn ein:e Amerikaner:in, Skandinavier:in oder Franzos:in sich in der Landessprache übt? Oder ist dieses «Komische» nur den deutschsprechenden Fremden vorbehalten?
Ich kam als junge Pfarrerin in die Schweiz und merkte schnell, wie hoch die Sprachbarrieren sein können, wenn ich Schriftdeutsch (übrigens: das Reinste! 😉) sprach und mein Gegenüber automatisch in den Schul- oder Tourismus-Reflex verfiel, ebenfalls Deutsch sprechen zu müssen. Aber dieses Deutsch behindert(e) die emotionale Sprachfähigkeit. Herzensangelegenheiten lassen sich am besten in der Muttersprache sagen – das wollte ich ermöglichen. Also übte ich mit dem Hund, liess mich von meiner Schwiegermutter betreffend Wortschatz und Grammatik korrigieren und radebrechte. Mit Erfolg. Die Menschen konnten sich emotional und sprachlich öffnen, selbst wenn manchen wohl nicht bewusst war, warum sie mit mir in ihrer Mundart sprachen, obwohl ich doch Deutsche bin. Mission erfüllt: Kommunikation gelungen.
Seither nehme ich gern in Kauf, dass mein Schweizerdeutsch «komisch» klingt und ermutige alle Landsleute, es ebenso zu halten. Auch das ist ein Stück Integration, die – wie jede Integration – auf Gegenseitigkeit beruht.