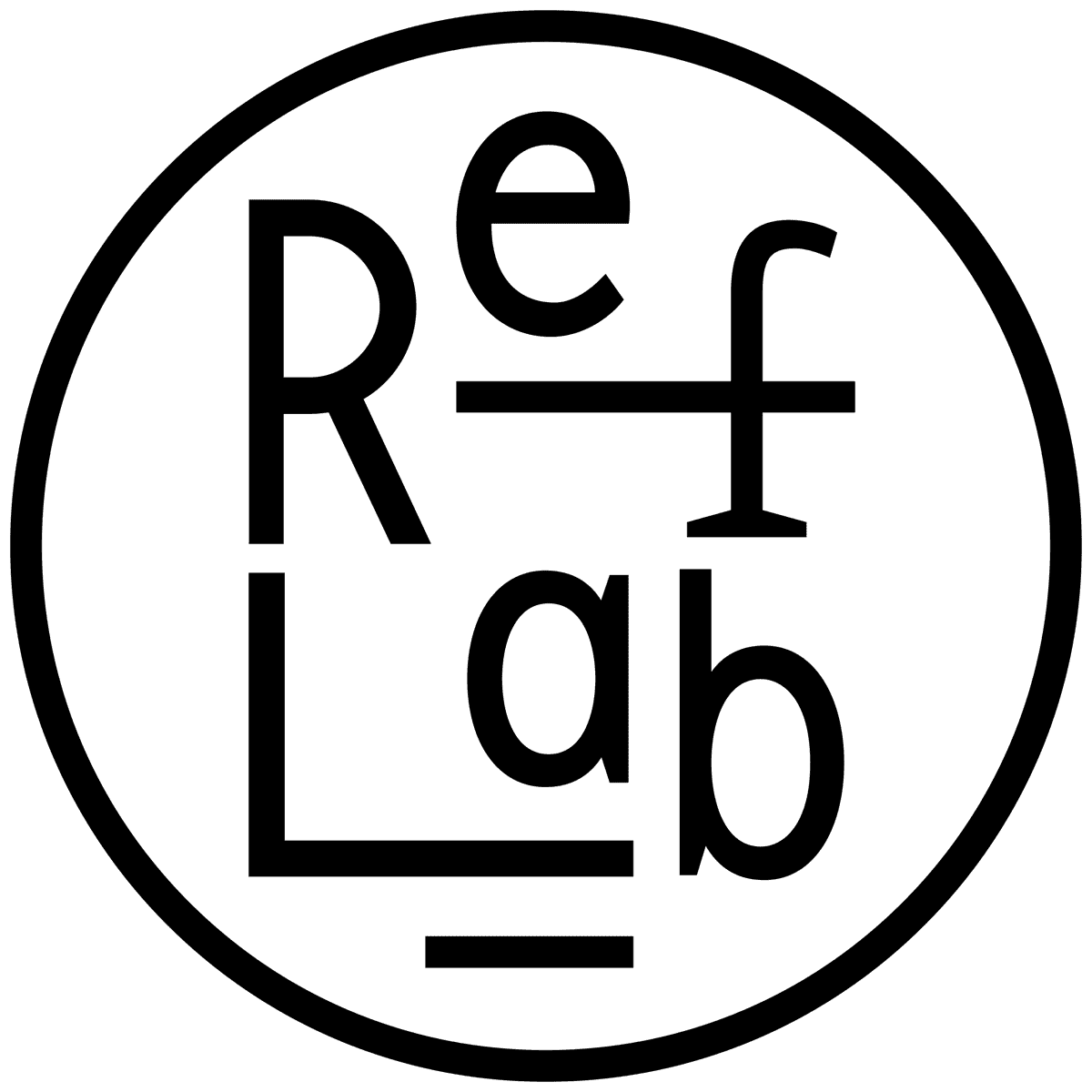Die französische Philosophin und Mittelschullehrerin Simone Weil (1909–1943) antwortet überraschend einfach auf die Frage, warum es überhaupt noch «Religion» braucht. Mit «Religion» meint sie jene besonderen Räume, Zeiten und Begegnungen, die dem Leben eine Grundlage für inneren Halt, Würde und Richtung geben. Heute würde sie wahrscheinlich ein anderes Wort wählen als damals im Jahr 1942, während sie als Jüdin auf der Flucht vor den Nationalsozialisten in Landgemeinden der Provence untergetaucht lebte.
Simone Weils Antwort lautet: «Religion besteht in nichts anderem als einem bestimmten Blick.» Und wir brauchen diesen Blick.
Was wir sehen, blickt uns an!
Weil beginnt ihr Nachdenken über Gott und die Welt nicht bei Glaubenslehren oder Gottesbildern. Sie setzt bei einer Mikropraktik im Alltag an.
Jedes Mal, wenn wir etwas oder jemanden ansehen, liegt darin das Potenzial, unser Leben grundlegend zu ändern.
Beim ersten Aufschlagen der Lider am Morgen, beim flüchtigen Blickkontakt mit Menschen und Dingen, denen wir auf der Strasse begegnen: die Art und Weise, wie wir schauen, bestimmt, wohin wir im Lauf unseres Lebens gehen.
Dabei geht es Simone Weil beim Sehen nicht um das rein Optische. Sehen ist nie nur Sehen. Was unser Auge beeindruckt, tritt immer mit dem ganzen Körper in Kontakt, berührt all unsere Sinne, selbst dann, wenn wir vieles von dem, was wir in uns aufnehmen, gar nicht bemerken. Was die junge Französin an einer «Kunst zu sehen» interessiert, ist die innere Haltung, die Ausrichtung unserer Seele, die wir beim aufmerksamen Hinschauen einnehmen.
Sehen stiftet Präsenz und Beziehung.
Was wir sehen, blickt uns an. Wir treten in Kontakt. Je weiter unser Blick ins Offene reicht, desto tiefer dringt das Aussen in unser Inneres – unabhängig von der tatsächlichen Entfernung dessen, was wir ansehen.
Die tägliche Übung des Sehens wird damit wichtiger als traditionelle Frömmigkeitsformen oder religiöse Rituale. Ein wacher Blick kann berühren, verwandeln, heilen. Sehen beinhaltet eine eigenständige, umfassende Spiritualität.
Die Leiden anderer betrachten
Was meint Weil genau mit einer spirituellen Praxis des Sehens? Geht es darum, «mehr» oder «besser» zu sehen, tiefer vorzudringen und bislang Verborgenes endlich sichtbar zu machen? Es geht ihr gerade nicht um ein elitäres «Ich sehe was, das du nicht siehst.» Bei den Weil’schen «Exerzitien im Alltag» rund um das Sehenlernen geht es um etwas anderes: um die Beziehung vom Ich zum Du. Um Gegenwart und Verwandlung. Sie schreibt:
«Das Wesen aller Nächstenliebe besteht darin, fähig zu sein, sein Gegenüber zu fragen: Was ist deine Qual? Es bedeutet zu wissen, dass der Unglückliche existiert – nicht als eine Einheit in einer Menge, nicht als ein Exemplar der sozialen Kategorie ‹Unglückliche›, sondern als Mensch, genau wie wir, der eines Tages vom Unglück getroffen und mit einem unverwechselbaren Zeichen gezeichnet wurde. Dazu reicht es aus – und es ist zugleich unverzichtbar – ihm einen bestimmten Blick zu schenken.»
«Dieser Blick ist zunächst ein aufmerksamer Blick, in dem sich die Seele von allem eigenen Inhalt leert, um in sich das Wesen des anderen aufzunehmen, so wie der andere ist, in seiner ganzen Wahrheit. Dies vermag nur derjenige, der zur Aufmerksamkeit fähig ist.»
Die ethische Verantwortung, dem Gegenüber diesen «bestimmten Blick» zu schenken, wird zu einem Indiz, um zwischen echter und falscher Empathie zu unterscheiden. Es bedeutet, eingefleischte Wahrnehmungsmuster zu hinterfragen. In der Auseinandersetzung mit dieser «Ethik des Blicks» und der Frage, wie Empathie möglich wird, ohne das Gegenüber zum Objekt von Mitleid zu degradieren, nimmt Susan Sontag Weils Ansatz auf und untersucht damit die Darstellungen des Leidens anderer und ihren medialen Einsatz.
Er in unseren Augen
Wie aber gelingt es, jemanden mit diesem «bestimmten Blick» anzusehen? Weil wendet sich als Nicht-Christin gezielt an Christinnen und Christen und fragt sie, wie sie es mit der geistlichen Praxis des Sehens halten – im Fall der hier überlieferten Texte an den blinden Dominikanerpater Joseph-Marie Perrin. Sie schreibt ihm: «Welcher Mensch könnte das unterscheiden, wenn nicht Christus selbst mit seinem Blick in unseren Augen schaut?»
Wer meint, so Weil, mit eigenen Vorstellungen davon, wer Christus ist, bereits «richtig» zu sehen, hat sie gründlich missverstanden und sollte noch einmal hinsehen. Weils Zuspitzung lautet: In der Praxis des Sehens entscheidet sich für Christinnen und Christen nichts Geringeres als ihre Beziehung zu Christus selbst (hier ein Link zur Vertiefung). In der geistlichen Übung des Sehens entdeckte Weil das noch ausstehende Wesen des Christentums:
«Der Blick ist das, was rettet», erklärt sie. Und das sei, fügt sie hinzu, «eine der grundlegenden Wahrheiten des Christentums.»
Damit geraten wir in einen Zirkelschluss: Sehen wird zur ersten und entscheidenden Tätigkeit, die zwischen Empathie und Hass, Gott und Götze, Klarheit und Verzerrung, Wahrheit und Lüge unterscheidet.
Doch wie, liebe Simone Weil, lernt man denn wirklich zu sehen?
Wie geht Sehen?
Sehen heisst vor allem: den Blick nicht abzuwenden und sich in aller Blösse hinzuhalten mit allem, was man gerade ist und erlebt, dem Gegenüber, der Welt, dem Augenblick. Für diese innere wie äussere Haltung verwendet sie das Wort attention, Aufmerksamkeit. Es meint einen wachen, geduldigen Seelenzustand (attendre): hinsehen, warten, anwesend sein. In ihren Cahiers beschreibt sie diese Haltung so: «Methode, um Bilder, Symbole etc. zu verstehen: nicht versuchen, sie zu interpretieren, sondern sie so lange anzuschauen, bis das Licht hervorbricht.»
Es gilt nichts zu deuten, nichts zu erklären. Offen zu bleiben. Einer unbekannten Wirklichkeit Raum zu geben, die Freiheit zu schenken, sich allmählich zu zeigen – dann, wenn das Gegenüber von sich aus bereit ist.
Darum schreibt sie: «Der Blick und das Warten, das ist die Haltung, die dem Schönen entspricht. Solange man denken, wollen, wünschen kann, erscheint das Schöne nicht.» Schönheit meint hier nicht Geschmack oder Vorlieben, sondern die Erfahrung, dass sich etwas als so gut und stimmig zeigt, dass wir nichts daran ändern möchten. Wir freuen uns einfach, dass es ist, wie es ist.
In der Berührung mit dem Schönen treten Christinnen und Christen in Kontakt mit Christus selbst, so Weil an den blinden Dominikanerpater Perrin, und ergänzt:
«Die Schönheit dieser Welt ist das zarte Lächeln Christi, das durch die Materie zu uns kommt».
Wenn in einer Sternstunde, vielleicht in der Innigkeit mit einem anderen Menschen, dieses Lächeln Christi durchscheint, verliert der andere jedoch nichts von seiner Wirklichkeit, wird nicht zum blossen Medium. Der irdische Moment ist keine Hülle, hinter der das Eigentliche verborgen liegt. Weil formuliert es so:
«Der Nächste, die Freunde, die religiösen Bräuche, die Schönheit der Welt sinken nicht etwa zu unwirklichen Dingen herab, nachdem die unmittelbare Berührung zwischen der Seele und Gott stattgefunden hat. Im Gegenteil, all dies wird dann erst wahrhaft wirklich. Vorher waren es halbe Träume.»
Wesensschau
Zugleich macht Weil sich keine Illusionen darüber, wie religiöse Kontexte Barrieren aufbauen und Menschengruppen ausklammern. Deshalb will sie die Kirche in eine Wahrnehmungsschule schicken, gerade das Unscheinbare und das, was oft übersehen wird, neu in den Blick zu nehmen. Nicht religiöse Bilder oder künstliche Symbole, sondern die einfachen Dinge, die uns umgeben, sollen, so Weil, zu «Spiegeln des Unsichtbaren» werden, in denen sich der Mensch als wahres Du wiedererkennen kann.
Das Einnehmen anderer Perspektiven und das Schauen unter neuen Lichtverhältnissen bedeutet nicht, sich einfach an neue Umgebungen anpassen zu müssen. Beim Blick mit geschlossenen Lidern und beim Lauschen auf die stillen Töne des Lebens geht es nicht um eine Verfeinerung unseres Sensoriums oder die Erweiterung unseres Zugriffbereichs, sondern um Verwandlung.
Im Sehen liegt ein ungeahntes transformatives Potenzial.
Im Blick auf das Stille und Unscheinbare kommt es zu einem tieferen Kontakt mit dem Anderen, der Wirklichkeit des Du, als es sonst in den Spiegelungen eigener Projektionen möglich wäre. «Jedes Wesen ist ein stummer Schrei danach, anders gelesen zu werden», schreibt sie. In der Seh-Schule des Unscheinbaren entdeckt Weil einen Weg, dem anderen wirklich zu begegnen – in seiner Andersheit, ohne ihm sein Geheimnis zu nehmen und ohne ihm etwas überzustülpen, das er nicht ist.
Das Unscheinbare und das aller Augen Entzogene eröffnet uns die Möglichkeit, eine innere Haltung zu entfalten, die auch im Angesicht von Leid, Gewalt und schmerzhafter Sinnlosigkeit nicht zerbricht, sondern im Stillen Kraft gewinnt.
Simone Weils Hang, sich schonungslos allem Leiden und den grössten Schmerzen auszusetzen – oft vorschnell als psychologische Störung oder religiöser Fanatismus missverstanden – hat seine andere Seite in genau dieser Aufmerksamkeit für das Unscheinbare und Kleine: Hier liegt eine verborgene Kraftquelle, die es ihr ermöglicht, die Schönheit der Welt und die grösste Grausamkeit nebeneinander auszuhalten und beides zugleich zu sehen, ohne auszuweichen.
Vielleicht ist es nicht zufällig, dass sie all das einem blinden Priester schreibt.
«Bedeutungslos» gewordene Kirchen …
Simone Weil wurde 1909 in eine jüdische Familie geboren, weigerte sich jedoch, sich über Zugehörigkeit bestimmen zu lassen und Jüdin genannt zu werden. Sie vertraute dem Evangelium, ohne einer Kirche beizutreten. Die Verfolgung von Häretikern in der katholischen Kirche kritisierte sie scharf und bezeichnete sie als Götzenverehrung. Zugleich arbeitete sie daran, das konkrete kirchliche Leben vor Ort neu zu beleben.
Weil mied jede Form kirchlicher Gemeinschaft, die mit Macht auftrat, und hinzeigt statt hinzuschauen.
Heimat fand sie in armen Pfarren Südfrankreichs und in einer afroamerikanischen Baptistengemeinde in der Bronx – in verwundeten und vermeintlich «schwachen» Gemeinden. Dort konnte sich die Wahrheit des Christentums erstmals unverstellt zeigen. Was Christus gesät hatte, war nach ihrer Überzeugung in den vergangenen zwei Jahrtausenden noch nicht aufgegangen.
Die Wahrheit des Christentums liegt nicht hinter uns, sondern vor uns – in der Art und Weise, wie wir auf die Welt blicken, im Wagnis, in die Tiefe zu gehen.
… als Schule, anders zu sehen
In ihrer Machtlosigkeit und Randständigkeit, wenn alle kirchlichen Selbstbilder zerschlagen sind, können gesellschaftlich bedeutungslos gewordene Kirchen zu Orten werden, an denen ein «bestimmtes Sehen» möglich wird. Sie bieten Zuflucht und Freiräume für das, was sich nicht sofort zeigt, für das, was in der Regel übersehen wird oder unsichtbar bleibt. Die säkulare Welt wird dabei zur entscheidenden Sehhilfe: Im Nicht-Mehr-Religiösen können sich die Augen der Kirchen anders öffnen – weg vom verschwommenen Blick unter der Wasseroberfläche bequemer Welterklärungen, hin zu einem wachen neuen Sehen.
So wurde Simone Weil für mich zur Anfrage an kirchliche Handlungsfelder heute. Wer anders sehen lernt, wird von dem, was zurückblickt, berührt und verwandelt.
Wer anders sehen lernt, wird anders gegenwärtig, lebt anders in der Welt und in Gemeinschaften.
Darin liegt die Chance, mutig und wach Orte und Begegnungsräume zu schaffen, in denen Sehen als geistliche Übung erprobt und die Suche nach Wirklichkeit gemeinsam unternommen wird – jenseits von gesicherten Glaubensbekenntnissen zur Selbstbestätigung.
Plattformen einer sehenswerten Welt
Kirchen können – und sind es vielerorts bereits – Aussichtsplattformen für gemeinsame Seherfahrungen in einer sehenswerten Welt sein. Sie bieten Räume, in denen es möglich wird, Zeugnis abzulegen, dass das unmittelbar Sichtbare nicht alles ist und dass jedes Wesen anders gelesen werden kann.
Kirchen können Orte sein, an denen sich Augen ausruhen dürfen und die «Kunst zu sehen» ihre ganze Vergegenwärtigungskraft entfalten kann.
Und auch heute gilt, was Simone Weil 1942 an die Landpfarreien über die spirituelle Praxis des Sehens schreibt:
«Nichts ist notwendiger und dringlicher als genau diese Transformation.»
Zusammen mit Mae Bengert (Berlin) und Max Walther (Leipzig) arbeitet der Theologe und Religionslehrer Tom Sojer seit 2019 als das Simone-Weil-Denkkollektiv: Vom 31.03. bis 16.06.2026 realisiert der Schweizer Künstler Thomas Hirschhorn gemeinsam mit mehreren Dutzend Künstler:innen – darunter das Simone-Weil-Denkkollektiv – für elf Wochen in Genf den Pavillon Simone Weil: Dort werden unterschiedliche künstlerische Praktiken sieben Tage die Woche öffentlich mit dem Denken Simone Weils in Berührung gebracht. Ein ähnliches Monument realisierte Hirschhorn 2002 für Georges Bataille.
Leseempfehlungen zu Simone Weil
- Simone Weil: «Das Unglück und die Gottesliebe»
- Simone Weil: «Schwerkraft und Gnade»
- Simone Pétrément: «Simone Weil. Biographie»
- Simone Weil: «Religiöse Schriften»
- Marie Schülert: «Achtsamkeit in der Pädagogik Simone Weils mit besonderem Akzent auf der Religionspädagogik»
- In seinem jüngsten Buch «Sprechen über Gott» setzt sich zudem der Philosoph Byung-Chul Han mit Simone Weil auseinander, hier ein Blogbeitrag dazu aus dem RefLab von Johanna Di Blasi.
Von Tom Sojer erschien bei TVZ der Erzählungsband: «Lichtdurchlässig»
Foto: Simone Weil, 1942 in New York; Wikimedia Commons.