Heiraten und Kinderkriegen
Ich hab mit 21 geheiratet. Im evangelikal-fundamentalistischen Umfeld meiner Jugendzeit war das keine Besonderheit. Kein Sex vor der Ehe und so.
Und natürlich wollten wir Kinder haben. Die Entscheidung zur Heirat und diejenige zur Familiengründung waren in diesem Milieu sozusagen identisch.
Wir haben damit allerdings doch lange zugewartet, weil wir zuerst unser Studium beenden wollten, bevor wir uns mit dem Nachwuchs beschäftigten. Zumal mein Studium hat sich dann verdammt lange hingezogen. Nach fünf Jahren an einem staatsunabhängigen theologischen Seminar hab ich an der Universität Basel nochmal den «ordentlichen» Bachelor und Master nachgeholt.
Und auch wenn ich da schon eine Teilzeitstelle als Pastor innehatte und meine Frau voll berufstätig war: Uns fehlte nicht nur die Zeit, sondern auch das Geld, um an die Gründung einer eigenen Familie zu denken.
Der richtige Zeitpunkt
In diesen Jahren habe ich regelmässig 60 bis 70 Stunden pro Woche gearbeitet und studiert (es heisst ja schliesslich: «Sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten sollst du ruhen. Und Gottesdienste halten…», oder so ähnlich…). Mein Pastorengehalt war noch unter dem Lohnniveau einer Reinigungskraft. Ohne dass wir es damals so benannt (oder ernsthaft darunter gelitten) hätten, lebten wir auf weiten Strecken am Existenzminimum.
Der richtige Zeitpunkt stellte sich einfach nicht ein, die nötigen Ressourcen wollten nicht freiwerden, um das Kinderkriegen guten Gewissens zu wagen.
Schliesslich hat uns dann gewissermassen der biologische Zeitdruck zur Vernunft gebracht: Wir waren schon über 10 Jahre verheiratet und also deutlich jenseits der 30er-Grenze – und sagten uns: Wenn wir das wirklich wollen, dann müssen wir die Zeit dafür freimachen. Irgendwie wird auch das Geld dann reichen.
Pläne und Erwartungen
Und so war’s dann auch. Mehr oder weniger. Aber natürlich kamen die Kinder nicht sofort.
Sich für eine Familiengründung entscheiden und tatsächlich schwanger werden, das sind zwei verschiedene Paar Kinderschuhe, sozusagen.
Wir waren 34 Jahre alt, als unser Sohn zur Welt kam. Knapp zwei Jahre später folgte dann unsere Tochter. Beide «gsund und gfrässig», wie man in der Schweiz sagt.
Welche Vorstellungen und Erwartungen wir mit dem Elternsein verknüpft haben, habe ich im Rückblick nur noch unscharf vor Augen. Zweifellos waren da romantische und verklärte Motive mit dabei, und gewiss haben auch bürgerlich-konservative Lebenskonzepte eine Rolle gespielt.
Da war aber auch der ernsthafte und durchdachte Wunsch, individuell und als Paar nicht bei uns selbst zu bleiben, sondern gemeinsam etwas Neues zu schaffen und nochmal in ganz anderer Weise Verantwortung zu übernehmen.
Vier Quadratmeter Glück
Die erste Zeit mit Kleinkindern stellt bekanntermassen alles auf den Kopf; und sie schafft ganz neue Gewohnheiten und Rituale. Bei uns ertönte jeden Morgen so gegen sechs Uhr aus dem Kinderzimmer der eindringliche Ruf nach Nahrungszufuhr: «Schoppä!», hiess es dann im Chor. Wir haben die Kinder jeweils in unser Ehebett genommen und ihnen das Milchfläschchen gegeben, während wir selbst unseren Morgenkaffee tranken.
Das waren zehn Minuten reiner Seligkeit zum Einstieg des Tages, ein heiliger, unbeschwerter Moment, den ich vor allen Herausforderungen und Beschwerlichkeiten des Tages mit der Familie teilen konnte. Ich weiss noch, als ich eines solchen Morgens in unserem Bett lag und mich die Einsicht überfiel:
Das für mich Wertvollste und Bedeutsamste überhaupt, jene Menschen, ohne die ich mein Leben weder denken kann noch will, befinden sich auf dieser Matratze. Vier Quadratmeter Lebensglück.
Wo ist mein Leben geblieben?
Bevor dieser Beitrag aber in Rührseligkeit aufgeht, muss auch das andere gesagt sein. Es lässt sich an einer Zahl illustrieren, die viele vorhin vielleicht überlesen haben: Sechs Uhr. Nicht nur werktags. Auch an Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien, auch dann, wenn man es bitter nötig und hart verdient hätte, mal etwas länger zu schlafen. Etwa nach einer wegen Kindergeschrei durchwachten Nacht.
Auch in dieser Hinsicht ist mir ein Moment in unauslöschlicher Erinnerung geblieben. Unser Sohn hatte uns die halbe Nacht auf Trab gehalten, wir waren völlig auf den Felgen. Um meiner Frau wenigstens ein bisschen Ruhe zu verschaffen, hatte ich unser Kind morgens um halb vier Uhr mittels Tragetasche vor die Brust geschnallt und war mit ihm durchs Quartier gezogen.
Da ging eine ausgelassene Schar Jugendlicher an mir vorbei, ganz offensichtlich auf dem Heimweg nach einer durchgefeierten Nacht. Im totalen Zombie-Modus trifft mich die Erkenntnis: «Das warst du noch vor wenigen Jahren! Was ist bloss aus deinem Leben geworden?»
Und wie war dein Wochenende?
Diese besonders anstrengenden Kleinkinder-Zeiten sind längst vorbei.
Aber bis heute gibt es diese Momente, an denen ich mich frage, wo mein Leben inmitten aller familiären Sachzwänge eigentlich geblieben ist.
Etwa wenn wir im Team am Montagmorgen eine Austauschrunde machen und einander vom vergangenen Wochenende erzählen. Der eine gibt zu, zwei komplette Staffeln einer Netflix-Serie geschaut und das Bett eigentlich nie verlassen zu haben. Die nächste war zwei Tage wandern, die Erholung in der Bergluft ist ihr ins Gesicht geschrieben. Jemand anderes hat mit dem Partner ein Kulturprogramm genossen: Samstags gediegenes Essen und ein Theaterbesuch, sonntags dann eine Kunstausstellung mit Gästeempfang.
Und ich denke zurück an zwei Tage, an denen ich unseren Sohn frühmorgens zum ersten Fussballspiel in ein vergessenes Kaff hinter sieben Bergen fuhr, um danach meiner Frau im fliegenden Wechsel das Auto zu übergeben, damit unsere Tochter rechtzeitig in Rheinfelden zum Eiskunstlauf erscheint, was mir die Möglichkeit gab, Zuhause die Fahrräder zu reparieren und der bald heimkommenden Schar etwas Feines zu kochen, um sodann die Badetasche für den Hallenbadbesuch am nächsten Tag zu packen, wo wir dann auch vier Stunden verbrachten, bis einem Kind einfiel, dass es noch Hilfe bei den Vorbereitungen einer Prüfung braucht.
Den Film, den ich mir abends endlich für mich ganz alleine gönnen wollte, habe ich dann verschlafen.
Lohnt sich das?
Es wäre zu platt, jetzt einfach mit der Beteuerung abzuschliessen, dass sich aber natürlich doch alles gelohnt hat und man die Kinder auf keinen Fall missen möchte. Natürlich stimme ich dem zu, aber es ist zugleich eine fragwürdige Perspektive.
Was heisst denn hier «lohnen»? Finanziell? Emotional? Gesellschaftlich? Der springende Punkt des Kinderhabens ist doch gerade, dass es die Verrechnungslogik aufsprengt, dass es ein Wagnis darstellt, welches eben nicht sauber kalkulierbar ist.
Kinder potenzieren das Risiko, das letztlich in jeder vertrauensvollen, intimen, hingebungsvollen Beziehung steckt. Und es gibt gerade keine Garantien, dass es sich «lohnt», dass man es immer noch einmal genau gleich machen würde, dass «unter dem Strich» ein Plus bleibt (schon wieder holt uns die ökonomische Sprache ein…).
Keine Garantien
Guten Freunden von mir wurden Kinder im Alter von fünf, sechs, zehn Jahren grausam entrissen. Krebs. Autounfall. Unerwarteter Herzstillstand. Andere erlebten, wie ihre Kinder «auf schiefe Bahn» gerieten, in Drogensüchte und missbräuchliche Beziehungen schlitterten. Oder sie mussten sie in psychiatrische Kliniken einliefern und wussten nicht, ob sie je wieder festen Boden unter die Füsse kriegen werden.
Nein, dass es sich in irgendeiner der erwähnten Hinsichten «lohnt», Kinder zu haben, lässt sich nun wirklich nicht versichern.
Und in bestimmten Momenten – wenn ich unseren aufgeregten Sohn zum ersten Schultag begleite und hoffe, dass «Bullying» für ihn noch lange ein Fremdwort bleibt; oder wenn unsere Tochter vor hunderten Zuschauern aufs Eis fährt, um ihre erste Kür zu bestreiten; oder wenn ein Kind zum Mittagessen viel zu lange nicht erscheint, bis ich anfange, verschiedene Lehrpersonen anzurufen, während in meinem Kopf die schlimmsten Horrorszenarien abspielen; und sicher auch wenn sie dann einmal mit Autofahren beginnen oder den ersten Liebeskummer erleben:
In diesen Momenten, die mir unmittelbar bewusst machen, wie unglaublich verletzlich ich mich mit diesen Kindern gemacht habe, wurde ich auch schon vom Gedanken überfallen: Wäre es nicht einfacher, sicherer gewesen, mit mir alleine zu bleiben?
Bestimmt. Aber Liebe ist weder einfach noch sicher. Und doch ist sie das Wagnis wert.
Siehe auch die Beiträge von Janna Horstmann und von Johanna Di Blasi zum Thema Mutterschaft und Kinderlosigkeit.
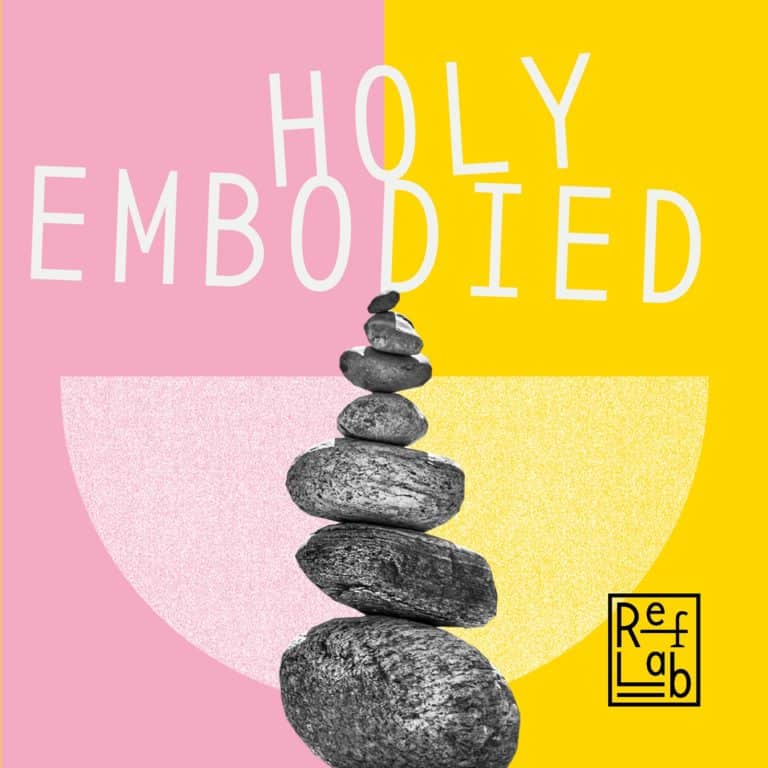
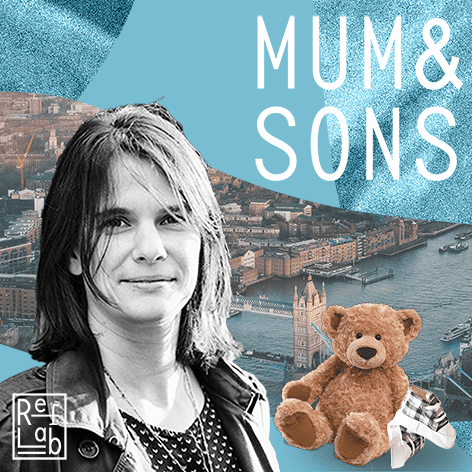




1 Kommentar zu „Vater sein“
Salü Manuel
Geh mal aus Deiner Froschperspektive in die grosse Welt des schöpferischen Geheimnisses: Die Kinder sind nicht für Dich geschaffen sondern umgekehrt, Du für sie!
Du kannst ihnen Lebensfreude vermitteln, Du kannst ihnen zeigen , was das Leben sinnvoll macht, Du kannst sie begeistern für das unsagbare Glück, hier und jetzt geboren zu sein. Und Du kannst dem Schöpfer dankbar sein, dass er Dir einen Ausweg aus Narzissmus und Nabelschau zeigt. Nicht Du sondern die Dir anvertrauten sind der Mittelpunkt der Welt.