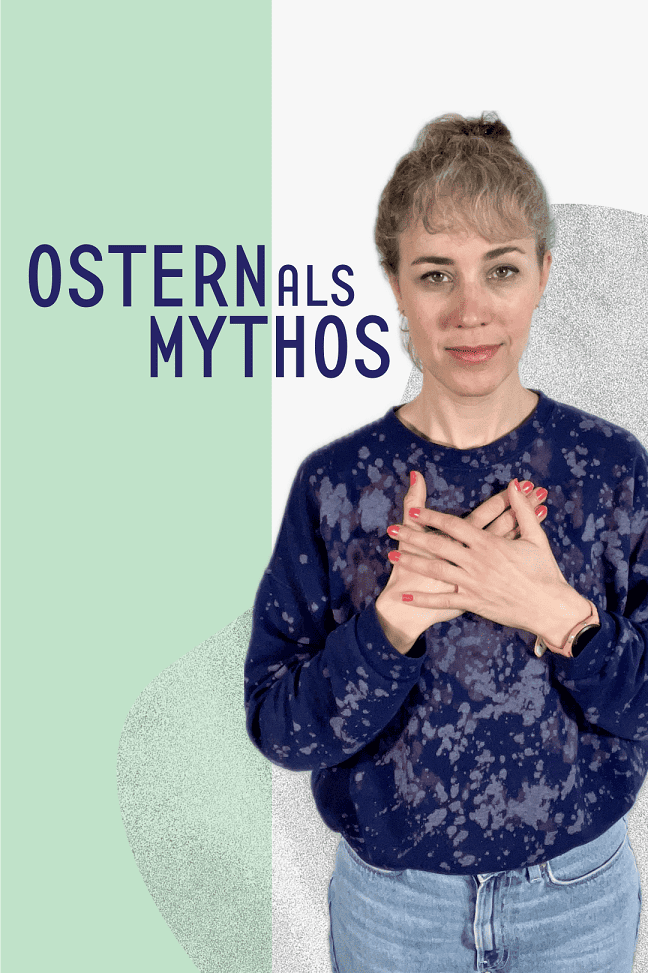Gründonnerstag 2006, Kino Splendid, Bern: Ich hatte gerade Zeit und entschloss mich, sie mit der Filmbiographie Walk the Line zu füllen. Meine Erwartungen an diese Hollywoodproduktion waren nicht allzu hoch, aber da ich die Musik von Johnny Cash ebenso liebte wie die Schauspielkünste von Joaquin Phoenix, hatte ich zumindest Gründe, mich bewusst emotional manipulieren zu lassen.
Trauma und Erfolg
Und tatsächlich: Ich leide mit dem traumatisierten jungen Johnny, der nie Liebe seitens des Vaters erfahren durfte, im Gegenteil: Der Vater hielt ihn für einen unnützen Träumer, der lieber am Radio sitzt und Musik hört, aber vor allem machte der Vater Johnny für den tragischen Unfalltod seines älteren Bruders verantwortlich.
Ich bin auf unangenehme Weise zusammen mit Johnny unerfüllt, wenn er aus einer Mischung aus Konvention und eingebildeter Liebe eine Familie gründet, irgendeinem Job nachgeht, aber eigentlich nach seiner eigenen Musik sucht, nach seinem Ton.
Ich treffe mit Johnny endlich den Ton, erzähle singend jene Geschichten, die ich in mir trage und habe dabei sogar Erfolg. Ich bin fiebrig On Tour, verliebe mich in meine Radiojugendliebe June Carter, beginne Pillen zu schlucken, riskiere und verliere Alles.
Tod und Auferstehung
Ich bin gesellschaftlich und künstlerisch tot, ein Wrack, sitze in einem Haus und nur weil June mit ihren Eltern die Drogendealer fernhält, komme ich langsam wieder auf die Beine. Ich erfülle einen Wunsch und singe vor fröhlich tobenden Gefängnisinsassen im Folsom State Prison. Ich bin wieder da, bin 36, June hat mich endlich geheiratet und ich stampfe meine Lieder aus dem rissigen, aber sicheren Boden.
Abspann
Das war’s also: Ein konventionell erzähltes Biographiedrama mit toller Musik, überzeugenden Schauspieler*innen und einem Happy End. Hollywood eben.
Aber als ich das Kino an diesem Gründonnerstag verliess, fühlte ich mich auf eine merkwürdige Weise gleichzeitig traurig und leicht, geschlagen und erfrischt, verloren und hoffnungsfroh.
Und plötzlich war da der Gedanke: Das war jetzt mein Ostern, ich hatte eigentlich dieselbe Geschichte durchlebt, die mindestens seit 2000 Jahren immer wieder erzählt wird. So war es denn auch:
Die 136 Minuten waren im Jahr 2006 mein Gottesdienst und ich spürte an den folgenden Tagen nicht das leiseste Bedürfnis, noch irgendeine kirchliche Feier zu besuchen.
Foto: Johnny Cash and June Carter Cash, Joel Baldwin – LOOK Magazine, April 29, 1969. S. 72.