Normalität?
In einem kürzlichen Interview bei Markus Lanz gibt der deutsche Philosoph und Bestsellerautor Richard David Precht zu bedenken, dass die aktuelle Lage bei aller Tragik auch enorme Chancen zur Veränderung bietet:
»Das Fenster, in Alternativen zu denken und sie vielleicht sogar zu leben, steht im Moment sperrangelweit offen – denn nie kann man Dinge besser ändern als in der Krise.«
Wir sind durch das Coronavirus aus dem gewohnten Lauf der Dinge, den wir so unreflektiert als »normal« bezeichnet haben, jäh herausgerissen worden. In vielen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens – nicht nur auf den Autobahnen – ist eine neue Ruhe und Nachdenklichkeit eingekehrt.
Der Vergleich mit einer kollektiven Entzugskur legt sich nahe: Zumal hinsichtlich der westlichen Spass- und Konsumgesellschaft fühlt sich der Corona-Lockdown an wie die Situation eines Suchtkranken, dem einige Wochen »Rehab« zugemutet werden.
In solchen Zeiten wird der Blick auf das geschärft, was man bisher zu Unrecht als »normal« verstanden und als »alternativlos« hingenommen hat. Der Abstand von den üblichen Betriebsamkeiten und Ablenkungsmechanismen des Lebens macht die Sicht für zivilisatorische Schieflagen so klar wie gegenwärtig das Wasser der venezianischen Kanäle.
Natürlich kann man danach auch wieder die eingetretenen Pfade beschreiten, die alten Selbstverständlichkeiten aufnehmen und den Wiedereintritt in die »Normalität« abfeiern.
Man kann – aber man muss nicht unbedingt.
Ich jedenfalls habe mir einige Zustände und Gewohnheiten notiert, zu denen ich lieber nicht zurückkehren möchte. Darunter sind persönliche Beobachtungen, die ich selber zu beherzigen habe, aber auch gesellschaftliche Zustände, deren Veränderung gemeinsame Bemühungen erforderte …
Mehr Ruhe
Es war an einem freien Samstag Ende März, mitten im Schweizerischen Corona-Lockdown. Verschiedene häusliche Arbeiten waren erledigt, die Kinder zogen in der Nachbarschaft um die Häuser. Also habe ich mich mit einem Buch in unserem Garten auf die Liege gelegt und angefangen zu lesen. Im Hintergrund höre ich die Vögel zwitschern, die Sonne wärmt mich wohltuend auf – und plötzlich durchzuckt mich der Gedanke:
»So zufrieden war ich schon seit vielen Monaten, vielleicht sogar Jahren nicht mehr!«
Nun ist es nicht so, dass ich mir sonst überhaupt nie eine ruhige Stunde im Garten oder sonstwo gönne. Es ist einfach nicht meine Stärke, solche Momente auch wirklich ungeteilt zu geniessen. Immer wieder schweifen sonst meine Gedanken zu alternativen Möglichkeiten der Betätigung oder Unterhaltung ab, zu Freunden, die man treffen oder zu Aufgaben, die man anpacken könnte. Ich scheine hier ein typischer Vertreter der »Generation Maybe« zu sein, der sich den Genuss den Augenblicks oft durch den Gedanken an die verpassten Optionen verderben lässt.
Die Auflagen des Bundes in der Corona-Krise haben nun zwar nicht alle, aber doch viele solcher Alternativbeschäftigungen schwierig gemacht – und mir eine Situation aufgezwungen, in der es am Samstagnachmittag vernünftigerweise kaum etwas anderes zu tun gab als das herrliche Wetter im heimischen Garten zu geniessen.
Meine Erkenntnis und mein Vorsatz für die Zeit nach dem Lockdown? Ich überlege mir, wie sehr ich mir meinen Kalender wieder ausfüllen lasse, welche Zusatzverpflichtungen ich eingehe.
Auch wenn die Zahl der alternativen Optionen mit zunehmenden Freiheiten wieder ansteigt, soll mir das nicht die Fähigkeit rauben, den Moment zu feiern.
Und so sehr ich mich auf die Besuche von Freunden und die Grillparties in der Nachbarschaft freue: Ich lasse mir die ungeteilte Freude an einem Buch im Garten am Samstagnachmittag nicht mehr nehmen!
Mehr digital
Als vierköpfige Familie gehören wir zu jenen Menschen, für welche die Order »Stay at home« kaum Gefahren der Vereinsamung oder der Langeweile mit sich brachte. Unsere Kinder haben von ihren Lehrpersonen ganze Listen von Aufgaben zugeschickt bekommen, die es unter Anleitung der Eltern zu erledigen gilt.
Nun haben viele geplagte Mütter und Väter in dieser Zeit den Lehrer*innen auf Social Media Anerkennung gezollt: »Jetzt sehen wir alle mal, was die sonst alles leisten!« Ich selbst bin mit den Lehrerinnen unserer Kinder wirklich überglücklich und zweifle an ihrem engagierten Einsatz keine Sekunde.
Die Zeit des Home Schoolings hat mich aber im Verdacht bestärkt, dass der entscheidende Beitrag der Schule nicht in der Wissensvermittlung liegt, sondern in ganz anderen Qualitäten.
Dazu gehört die Struktur des Tagesablaufes, das Miteinander in der Klasse, die Ausbildung zwischenmenschlicher Fähigkeiten, dann auch die Bewegung und die sozialen Interaktionen auf dem Schulweg und in den Pausen.
Was den Lernstoff selbst betrifft: Im Grossen und Ganzen haben sich unsere Kinder derart selbständig an die Aufgaben gemacht, YouTube-Tutorials geschaut, Online-Aufgaben gelöst und mit Apps ihre Fähigkeiten vertieft, dass ich mich gefragt habe: War wirklich eine Pandemie nötig, um unser Schulwesen aus der Steinzeithöhle ins digitale Zeitalter zu locken? Das soll keine Kritik an einzelnen Lehrpersonen sein, wohl aber die Anzeige einer Mangelerscheinung im Blick auf die Organisation von Bildung insgesamt:
Längst wäre es möglich, Teile der Wissensvermittlung über spannende und pädagogisch durchdachte Apps erfolgen zu lassen. Zuhause oder in Lernräumen könnten Schülerinnen und Schüler auf diese Weise ihr Lerntempo selber regulieren, zusätzliche Interessengebiete vertiefen und nebenbei ihre Medienkompetenzen verbessern. Lehrpersonen würden insgesamt wohl entlastet und könnten sich stärker um jene Schüler*innen kümmern, die besondere Begleitung und Betreuung brauchen. Wahrscheinlich würde sogar mehr Zeit für Sport und Bewegung frei. Schritte in diese Richtung wären m.E. schon lange fällig, und ich hoffe sehr, dass der forcierte Digitalisierungsschub an unseren Schulen nach der Coronakrise nicht einfach verpufft, sondern weiterführende Überlegungen zur Gestaltung des Schulunterrichts anstösst.
Mehr bezahlen
Meinen letzten Überseeflug habe ich vergangenen November angetreten. Im Auftrag der Universität Münster (an der ich noch zu einem kleineren Pensum als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig bin) durfte ich die Jahreskonferenz der »American Academy of Religion« in San Diego besuchen. 1’000 Franken habe ich für den Flug in der vorgängigen Reisekostenaufstellung veranschlagt. Aber ich lag weit daneben: Der Flug von Zürich nach San Diego und zurück hat gerade mal gute 400 Franken gekostet. Zwei Drittel davon waren Gebühren und Steuern, der Flug selber kostete, wenn ich mich recht erinnere, knappe 150 Franken.
Und das alles in einem Jahr, in dem sich das panische Gesicht einer Greta Thunberg ins kollektive Gedächtnis eingebrannt hat, wie sie in glühenden Worten vor der Klimakatastrophe warnt. Das alles in einer Zeit, in der die Bewegung »Fridays for Future« weltweites Momentum aufnahm und Protestaktionen von »Extinction Rebellion« für internationales Aufsehen sorgten.
Für 400 Franken in die USA und zurück.
In einem Land, in dem gefühlt jeder zweite Primarschüler mit einem iPhone für 800 Franken herumläuft und schon ein Abend zu zweit in einer Pizzeria locker 150 Franken kostet (mit dem schlechtesten Wein…). Kein Wunder sind da die Matura-Reisen ins Tessin oder ins Bündnerland aus der Mode gekommen – heute fliegt schon die Sekundarschulklasse zur Abschlussfeier nach Florida.
In den letzten Wochen ist nun der Flugverkehr aufgrund der Coronakrise weltweit fast zum Erliegen gekommen.
Das dichte Netz an Kondensstreifen am Himmel ist verschwunden, sogar in der Anflugschneise am Züriberg ist Ruhe eingekehrt … und eigentlich wäre das ein wunderbarer Zeitpunkt, das ganze System neu aufzusetzen.
Wenn Flugreisen wirklich für einen signifikanten Teil des CO2-Ausstosses verantwortlich sind, müsste es doch möglich sein, durch internationale Abkommen eine Umweltsteuer zu erheben und das Billigfliegertum zu unterbinden? Das könnte auch zu einem Umdenken in Grossunternehmen führen, da Geschäftsreisen immer noch den grössten Teil der Flüge ausmachen. Auf jeden Fall scheint mir das Reiseverhalten der westlichen Welt ein Punkt zu sein, an dem eine Rückkehr zur »Normalität« alles andere als wünschenswert ist…
Mehr einheimisch
Wenn die gegenwärtige Pandemie-Krise etwas mit unmissverständlicher Deutlichkeit gezeigt hat, dann ist es die tiefreichende Vernetzung unserer globalisierten Wirklichkeit.
Die Welt ist zum Dorf geworden, sagt man. Alternativ könnte man von einem gigantischen Mobile sprechen, zu dem die Menschheit zusammengewachsen ist: Alles hängt aneinander, und wenn man an einer Stelle zieht, bewegt sich irgendwann das ganze Konstrukt.
Ein Virus in China, anfangs kaum eine Schlagzeile wert, findet so seinen Weg über den Personen- und Güterverkehr in die ganze Welt. Und auch dort, wo das Virus noch nicht angekommen ist, waren die Konsequenzen längst zu spüren – denn wenn China Fabriken schliesst und Arbeiter nach Hause schickt, dann wir die Supply Chain hiesiger Unternehmen gestört, dann werden Einzelteile nicht mehr geliefert, dann stockt es an Orten und Enden, die man mit einem Virus nie in Verbindung gebracht hätte.
Das macht nachdenklich im Blick auf die profunden Abhängigkeiten, welche gerade westliche Staaten eingehen. Sicher: Wir gehören zu den überragenden Gewinnern und Nutzniessern der Globalisierung. Aber wenn sich dann die Landesgrenzen mal für einige Wochen schliessen, wird erst klar, wie verletzlich und störungsanfällig unser System eigentlich ist.
Nachrichten zur Früchte- und Gemüseernte aus Deutschland haben das eindrücklich vor Augen geführt: Weil die gut 300’000 (!) Erntehelfer, die sonst v.a. aus Rumänien und Polen eingeflogen wurden, nicht einreisen durften, standen die lokalen Landwirte in der Gefahr, die gesamte Ernte zu verlieren. Durch besondere Reisegenehmigungen und den Einsatz von Geflüchteten wurde der Notstand vorerst abgewendet.
Mit dem Beispiel aus Deutschland will ich keinesfalls die Situation der Schweiz beschönigen. Der Fall ist einfach besonders markant: Die Ernte eines der reichsten Länder der Welt droht vor den Augen der Bevölkerung zu verrotten, weil schlicht die Arbeiter*innen fehlen, die bereit sind, zum Billiglohn Spargeln zu ziehen und Erdbeeren zu pflücken.
Einfache Lösungen dieser Problemlage habe ich nicht im Ärmel – aber ganz sicher wird es nicht ohne die Bereitschaft gehen, für die eigene Ernährung wieder mehr Geld auszugeben. Wenn ein Kilo Erdbeeren oder ein Bund Spargeln noch 3 Franken (oder Euro) kosten darf, dann geht das nicht ökologisch, und schon gar nicht mit Arbeitenden, die anständig bezahlt werden. Gerade in der Schweiz, welche in den vergangenen Jahrzehnten einen nie dagewesenen Wohlstandszuwachs verzeichnet, müsste es eigentlich möglich sein, auf systemischer Ebene eine Veränderung herbeizuführen und nach der Krise nicht einfach zum Status Quo zurückzukehren.
Und Sie?
Diese Liste ist natürlich unvollständig, und die genannten Punkte von ganz unterschiedlicher Schwere und Tragweite. Besonders der letztgenannte bräuchte wesentlich mehr Ausführung und Vertiefung. Ich lasse es aber doch bei dieser kleinen Aufzählung bewenden und spiele die Frage dafür an Sie zurück:
Wohin wollen Sie nach der Krise nicht zurück? Welche Chancen für persönliche und systemische Veränderungen sehen Sie als Konsequenz aus dem pandemiebedingten Ausnahmezustand?


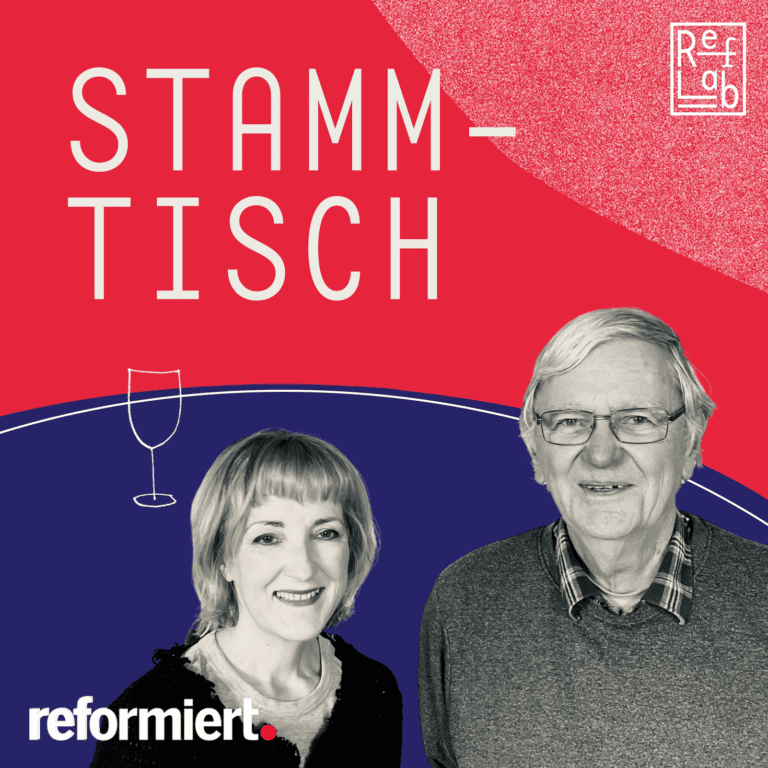





9 Kommentare zu „Ich will gar nicht zurück!“
Ich wünsche der erde, dass die menschen sehen, wie gut sich die natur, das wasser , die luft in kurzer zeit erholt haben. Und die bevölkerung bereit ist, mit weniger mehr lebensqualität zu erreichen, heisst. Wertschätzen kann, und schützen möchte was an schönem vorhanden ist. Die erde kann ohne den menschen leben.. der mensch aber nicht ohne seine erde.. ich hoffe, dass die bilder der tiere in den strassen, und in den saubereren flüssen die augen öffnet, und der gier einen riegel schiebt.
Ich hoffe, dass ein sanfter tourismus, und eine begrenzung der gäste in den hochburgen der ferienorte eingeführt wird. Und dass die menschen, welche in den ärmsten orten der wirtschaftlich benachteiligten ländern nicht vergessen gehen.. wieviel sind dort von den sekundärfolgen des lockdown betroffen..der reiche westen darf sich da keine wegschausünde aufladen.
Weise Gedanken und wertvolle Ansätze!! Mögen diese Wurzeln schlagen und sich schnell und tief eingraben, dass die gelebte Normalität von früher keine Chance hat und die kommende noch gestaltbare Wirklichkeit das aufkeimende Pflänzchen der Vernunft nicht schnell überwachsen kann. Wenn wir je eine Zeit hatten unser Tun und Lassen zu reflektieren dann in den letzten Wochen. Behalten wir das Gute, lassen wir das Negative und lernen wir wieder verantwortungsbewusst zu leben, – ganz persönlich!!
Die Frage ist für mich nicht ganz eindeutig zu beantworten, wo wir selbst das System am Laufen halten, das uns letztlich ermüdet, und wo es das System ist, das uns die Pace aufzwingt…
Möge es gelingen, daß wir uns die vielleicht ganz neu gewonnenen Spielräume erhalten und behaupten. Die Kraft der individuellen Gestaltung ist eben nicht zu unterschätzen… wie der berühmte Stein, der ins Wasser fällt und irgendwann große Kreise zieht…
Danke Simone für deine Reaktion! Ja, neu gewonnene Spielräume erhalten und behaupten – das gefällt mir!!!
Ich frage mich ob diese Mitmenschen, die in Vereinen sich engagieren, in den Vorständen, die x – Stunden den Musikvereinen schenken oder dem Samariterpostendienst….
….kehren die wohl zurück??!
Ich will gerne wieder dorthn zurück wo wir vorher waren. Ihre Übelegungen und Erfahrungen sind zwar schön und villeicht auch etwas romantisiert aber wir können sie nicht langfristig leben.
In dem Text vermisse ich z.B. unsere Sozialsysteme. Wenn wir weiterhin sowas wie AHV, IV, Sozialhilfe, Pensionskassen, etc anbieten wollen – müssen wir permanent wachsen. Das System basiert auf massiven Wachstum.
Und dieses Wachstum erreicht man nicht mit Kurzarbeit oder mit dem Lesen von Büchern im Garten – sondern nur durch schnelle harte Arbeit und masslosem Konsum.
Das die Globalisierung uns auch vor Probleme stellen kann ist klar. Und die Ernten in DE und Lieferketten in China sind gute Beispiele für das Problem. Aber auch hier gibt es nur wenig Möglichkeiten, wir können mit der Landwirtschaftlich nutzbaren Fläche in der CH nicht die komplette Bevölkerung der CH ernähren – sind da also auf Imprte angewiesen.
Und auch wenn wir uns unsere Alltäglichen Produkte ansehen – Smartphones, TV, selbstfahrende Auto 😉 das sind alles hochkomplexe Geräte – ein Land alleine (egal welches) wird kaum in der Lage sein – diese Geräte von A-Z (Materialgewinnung, Materialveredelung, Montage, Entwicklung der Software, Stresstest, etc) selber zu produzieren. Dies gilt für die Schweiz noch stärker als für DE oder die USA, weil unsere Löhne ja im Vergleich extrem hoch sind – diese Geräte könnte sich kein Mensch mehr leisten.
Danke für die kritische Rückmeldung! Ihre Beobachtungen kann ich weitgehend nachvollziehen, und der Hinweis auf den Zusammenhang der ausgebauten Sozialsysteme mit einem auf Wachstum angelegten Kapitalismus ist sicher berechtigt. Sie schreiben aber selber, dass unser System auf »schnelle harte Arbeit und masslosem Konsum« ausgelegt ist – das ist ja nicht nur eine Beschreibung, sondern auch eine Problemanzeige. Schon der Club of Rome hat ja damals von den »Grenzen des Wachstums« gesprochen, und bis heute gibt es ausgewiesene Ökonomen, die sich für die Etablierung eines alternativen Systems aussprechen. Um die Konturen solcher Alternativen zu zeichnen, bin ich sicher der Falsche – da fehlt mir der Einblick in die zahlreichen ökonomischen, sozialen, politischen, ökologischen (usw.) Zusammenhänge. An den Auswirkungen unserer wachstumsgetriebenen Konsumgesellschaft lässt sich aber doch zweifellos ablesen, dass es so nicht endlos weitergehen kann…
Ich bin jetzt auch nicht der „Hard-Core-Fan“ von grenzenlosem Wachstum, Konsum, und den damit verbundenem „Raubtierkapitalismus“.
Aber ich bin ich auch sehr vorsichtig, wenn man ein System ändern will. Wir hatten vor 1945 viele verschiedene Systeme in Europa – die jeweils direkt oder indirket in zwei furchtbaren Weltkriegen ihr Ende gefunden haben.
Das Problem an diesem grenzenlosen Konsmkapitalismus ist, dass er (jetzt nur auf die Gesellschaft und nicht auf Ressourcen und Ökosystem gemünzt) eben einigermassen funktioniert.
Wir sind alle krankenversichert, „alte“ Menschen können dank Rentensysteme in Würde altern, Menschen ohne Arbeit stehen nicht am Ende Ihrer Existenz, etc – das war früher alles anders.
Wir haben als Welt-Gesellschaft sicher nicht den besten Leistungsausweis den man haben könnte, aber man kann sagen, dass wir in den letzten 70 Jahren vorwärts gekommen sind.
Ich sehe ebenso all die erwähnten Aspekte und Perspektiven auf die hingewiesen werden und kenn mich zu wenig tiefgründig aus, um etwaige Vorschläge zu bringen. Jedoch möchte ich einen weiteren Kritikpunkt anbringen, denn aktuell scheint es mir so, dass lediglich für die „Angestellten“ gut gesorgt wird. Selbstständige und Kleinunternehmen, sowie die Kunst–und Kulturszene, haben große Hürden zu überwinden, um eventuell in einem westlichen Sozialsystem in Zeiten von Corona einen Platz zu finden.
Ich habe mir auch erst heute Gedanken zu der vielen persönlichen „mehr-Zeit“ gemacht und habe den Eindruck viele Menschen haben in den letzten Wochen (wieder) begonnen für sich zu kochen und haben sich ebenso der Gesundheit und Bewegung gewidmet – ist doch ein schönes Resultat auch, was man aus dieser Pandemie ziehen kann.. Ergo, brauchen die Menschen lediglich mehr Zeit, sprich weniger Arbeitsstunden, um gut für sich zu schauen, da die Kompromisse weniger werden.
Weniger Arbeitsstunden für die Einen, mehr Arbeitsstunden für die Anderen, wie zB Arbeitslose.. Würde das Sinn machen?