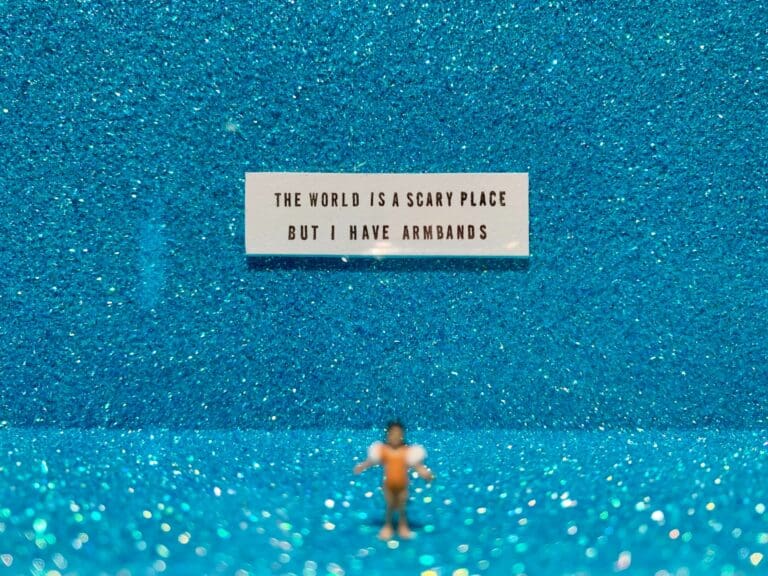Stellen Sie sich vor, Sie vernehmen auf einmal Hufgetrappel. Wahrscheinlich denken Sie an ein Pferd. Vielleicht auch an einen Esel oder ein Maultier. Aber könnte es auch ein Zebra sein?
Im Medizinstudium wird seit Jahren dieser Satz geprägt: «Wenn Sie hinter sich Hufgetrappel hören, erwarten Sie nicht, ein Zebra zu sehen.» Im Kontext bedeutet dieser Rat, dass die zukünftigen Ärzt*innen in ihrem Berufsalltag nach den häufigeren und üblicheren, nicht nach den überraschenden Diagnosen suchen sollten.
Seit Kurzem weiss ich, dass ich «ein Zebra» bin: Meine Krankheit gehört zu einer der seltensten in der Schweiz und betrifft nur etwa 1500 Menschen. Wie viele andere Menschen mit seltenen und chronischen Krankheiten suchte ich jahrelang nach Antworten: Ich war zu jung, um solche Schmerzen zu haben, zu normal, um so wenig belastbar zu sein, hatte zu gute Körperwerte, um mich ständig so angeschlagen zu fühlen.
Zermürbendes Nicht-Wissen
Wie zwei Zebras nie identische Streifen haben, sind auch die Symptome von Menschen mit einer seltenen Erkrankung selten identisch. Das macht die Diagnose schwierig und führt zu einem hohen Leidensdruck.
Das «Nicht-Wissen» über das, was man hat, kann zermürben, hat mich beinahe zermürbt.
Bis zur Diagnose vergehen oft Jahre, getrübt von Fehldiagnosen, Fehlbehandlungen, Stigmatisierung, psychischem Druck und finanziellen Sorgen.
Ich klaubte mir dieses Jahr meinen von mir über Jahre kleingehaltener, falsch-demütiger, calvinistisch geprägter Rest Selbstwert zusammen und kämpfte hartnäckig darum, nicht mehr länger mit ärztlichem «Wir wissen nicht, was Ihnen fehlt, höchstwahrscheinlich ist es die Psyche» abgespeist zu werden. Die internalisierte Scham war gross, doch die Schmerzen waren grösser und am Ende behielt ich recht: Es stimmte tatsächlich etwas nicht mit mir.
In Jesaja 43,1 steht: «Ich habe deinen Namen gerufen, du gehörst zu mir.» Ähnlich wie Gott uns durch unsere Eltern oder durch uns selbst einen Namen gibt, werden wir – wird etwas durch eine Benennung sichtbar.
Dem Leiden einen Namen geben
Die Diagnose der Multisystemerkrankung zu erhalten war, als würden meine Schmerzen zum ersten Mal anerkannt, als würde ich zum ersten Mal anerkannt. Mir wurde geglaubt.
Mit dem Namen meiner Krankheit, wurde dieses unsichtbare, schmerzende, diffuse Etwas in meinem Körper endlich zu einem benennbaren, fassbaren Teil von mir.
Es war nicht die Psyche. Es war schon immer mein Körper. Die Erleichterung gross.
Am «Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen» reihe ich mich also mit meinem Namen, Sarah und meinen körperlichen Einschränkungen durch das Ehlers Danlos Syndrom in eine Gemeinschaft von anderen Menschen mit körperlichen, geistigen, sozialen oder emotionalen Behinderungen ein. Eine Behinderung, so schreibt die UN-Behindertenrechtskonvention betrifft «Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.» (Artikel 1 Satz 2, www.behindertenrechtskonvention.info)
Es fällt mir noch nicht ganz leicht, dieses Wort als Beschreibung zu verwenden; denn Vorurteile, Exklusion und Negativbehaftung von Sprache ist besonders deutlich am Begriff «behindert» zu erkennen. Der Ausdruck löst in vielen Menschen unangenehme Gefühle aus. Doch Sprache befähigt auch und schafft Verständnis.
Durch die Sprache schenken wir dem Leben Schärfe und Kontur, sprechen aus und machen sichtbar.
Gänzlich neue Situation
Diese Sichtbarkeit beschäftigt mich auch in der Pandemie: Durch die für mich gänzlich neue Situation der Selbstisolation realisierte ich, wie vielen Menschen die uneingeschränkte Teilhabe am gesellschaftlichen und auch am kirchlichen Leben schon lange verwehrt bleibt. Hybride Angebote sind grossartig, doch wie steht es nach der Pandemie mit der Zugänglichkeit des Gottesdienstes, wie verständlich ist die Sprache von Pfarrpersonen, wie barrierefrei ist der Internetauftritt, wie sieht das vermittelte Gottesbild aus?
Für Betroffene kann es auf Dauer sehr ermüdend sein, Teilhabe immer wieder einzufordern. Sie brauchen Verbündete.
Trotz der körperlichen Einschränkungen bin ich sehr privilegiert. Als Mitarbeiterin der Evangelisch-Methodistischen Kirche weiss ich um die Vielschichtigkeit und die Herausforderungen der Inklusion.
Inklusion ist anstrengend. Doch sie ist die ureigenste Aufgabe des Christentums, in der Nächstenliebe gekennzeichnet.
Jesus bezeugte seine Auferstehung mit dem Vorzeigen seiner sichtbaren Wund- und Narbenmale und wurde damit zum sichtbaren Messias – ein körperbehinderter Retter für die ganze – gesunde wie kranke und behinderte Menschheit. Wie Jesus sind auch behinderte und kranke Menschen Zeug*innen der Verwundbarkeit, schrieb der erblindete Religionspädagoge John M. Hull. Sie brauchen zwischenzeitlich-gesunde Christmenschen und die Kirche als Mitwissende und Unterstützende – beide brauchen einander, weil allen Menschen Krankheit und Vulnerabilität begegnen.
Mensch- und Christmenschsein
Am Tag der Behinderungen wünsche ich mir darum besonders für Christ*innen ein ganzheitlicheres Verständnis dafür, wie Menschen mit und ohne Behinderung gleichwertig integraler Bestandteil der Gemeinschaft werden können. Ich wünsche mir auch eine vertiefte Auseinandersetzung mit exkludierenden Strukturen und Denkweisen. Ich wünsche mir, dass man auch an Zebras, nicht nur an Pferde denkt. Und ich wünsche mir, dass Menschen mit Behinderungen nicht länger als «zu integrierende Minderheiten» verstanden werden, sondern als grundlegender, sichtbarer Bestandteil – wie gesunde Menschen auch – als selbstverständlicher Ausdruck des Mensch- und Christmenschseins.
Ehlers Danlos Syndrome (EDS)
Die Ehlers-Danlos-Syndrome (EDS) umfassen eine vielfältige Gruppe angeborener Bindegewebskrankheiten. Es handelt sich um eine Multisystemerkrankung mit individuell unterschiedlicher Beteiligung des Bewegungsapparates, der Haut, der Blutgefässe, der Nervenbahnen, der inneren Organe und der Sinnesorgane.
Die Autorin Sarah Staub studiert Theologie, arbeitet für die evangelisch-methodistische Kirche Schweiz als Gemeindeentwicklerin und ist aktiv auf Instagram als „die fromme Häretikerin“ und als Teil des Kollektiv Glaubensweite.
Photo by Matteo Vistocco on Unsplash